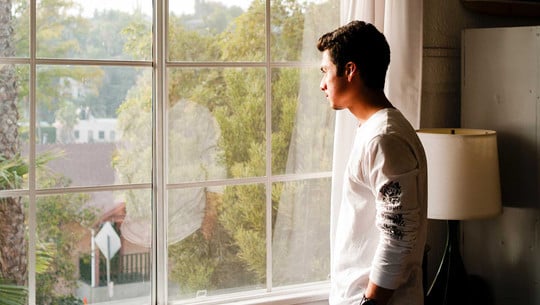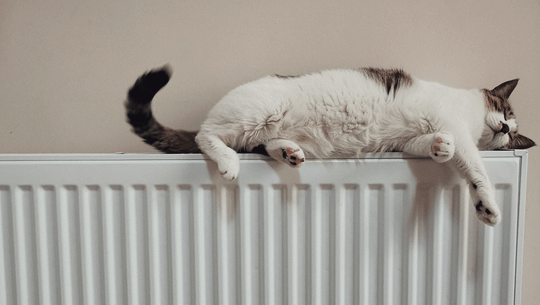Wärmepumpen und Balkonkraftwerke könnten eine Traum-Kombi sein. Die eine benötigt Strom, das andere liefert ihn. Dennoch ist die Kombination nicht ideal.
Obwohl einige Unsicherheiten bleiben, steigen die Absatzzahlen von Wärmepumpen dieses Jahr deutlich an – und liegen inzwischen über jenen für Gasheizungen.
Vor allem die Kombination aus einer Wärmepumpe und einer eigenen Solaranlage ist verlockend. Schließlich kannst du auf diese Weise deine Heizkosten senken, indem du die Heizung mithilfe deines eigenen Stroms betreibt. Doch beides zusammen ist teuer.
Könnte ein weitaus günstigeres Balkonkraftwerk reichen, um zumindest einen Teil der Betriebskosten abzufangen?
Warum Wärmepumpen und Balkonkraftwerke auf den ersten Blick zusammenpassen
Balkonkraftwerke und Wärmepumpen ergänzen sich auf den ersten Blick sehr gut. Schließlich liefern die Mini-PV-Anlagen Strom und die Heizung benötigt ihn.
Balkonkraftwerke funktionieren, indem bis zu vier Solarmodule mit maximal 2.000 Wp Gleichstrom erzeugen. Ein Wechselrichter wandelt ihn dann in Wechselstrom um und leitet ihn über eine gängige Schuko-Steckdose in den Haushalt. Dort können ihn alle Elektrogeräte direkt nutzen. Allerdings haben die Wechselrichter eine Begrenzung: Sie dürfen nur mit maximal 800 Watt einspeisen, um die Leitung nicht zu überlasten.
Eine Wärmepumpe benötigt Wechselstrom, um die eigentliche Pumpe außerhalb des Hauses zu betreiben. Diese zieht Wärmeenergie aus der Umgebung – aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser. Die Wärme wird dem Heizkreislauf zugeführt. Das System arbeitet extrem effizient: Eine Wärmepumpe benötigt zwar Strom, kann aber das Drei- bis Fünffache an Energie aus Umweltwärme ziehen. Wenn der Strom zudem aus erneuerbaren Energien stammt (zum Beispiel von der eigenen Solaranlage), dann arbeitet die Wärmepumpe klimaneutral.
Wärmepumpen und Balkonkraftwerke klingen also in der Theorie nach einem perfekten Paar, in der Praxis kommt es jedoch zu mehreren Problemen.
Problem 1: Strombedarf und Stromproduktion
Wie schon erwähnt, dürfen Balkonkraftwerke nur mit maximal 800 Watt ins Hausnetz einspeisen. Das ist nicht besonders viel, da bereits einige Haushaltsgeräte wie etwa Wasserkocher, Mikrowellen und Staubsauger diese Grenze überschreiten. Zudem gibt es in jedem Haushalt eine Grundlast durch immer laufende Geräte wie Kühlschränke oder Router. Sie liegt meist bei etwa 100 bis 200 Watt, kann aber in größeren Haushalten auch weit darüber liegen. Von den maximal 800 Watt würde also nur ein Teil für die Wärmepumpe zur Verfügung stehen.
Zudem spielt die Tageszeit und das Wetter eine Rolle. Selbst bei einer Modulleistung von 2.000 Wp kann die Stromproduktion auch unter 800 Watt sinken. Wenn beispielsweise nur noch 400 Watt in der Steckdose landet und davon 200 Watt die Grundlast decken, dann blieben nur 200 Watt für alles andere im Haushalt – und für die Wärmepumpe.
Eine Wärmepumpe benötigt jedoch viel mehr Strom. Wie viel genau kommt immer auf die Größe der Anlage und der Außentemperatur an. Zudem läuft sie nicht konstant mit derselben Leistung durch. In der Regel liegt die Leistung aber immer bei mehreren Kilowatt und damit weit über dem, was ein Balkonkraftwerk einspeisen kann. Typische Größen sind 1 bis 3 kW, die Spitzen können aber bis weit über 5 kW gehen.
Problem 2: Kaum Überschneidungen bei den Laufzeiten
Auch wenn die Wärmepumpe mehr Leistung benötigt, als ein Balkonkraftwerk zur Verfügung stellt, könnte dieses ja zumindest einen Teil kleinen Teil abdecken. Denn jede selbst verbrauchte Kilowattstunde des eigenen Solarstroms spart bares Geld.
Zwar ist dieser Gedanke korrekt, jedoch gibt ein weiteres Problem: Balkonkraftwerke produzieren dann am meisten Strom, wenn Wärmepumpen üblicherweise wenig laufen. Der größte Teil des Stroms entsteht im Sommer, während die Haushalte wenig Heizenergie benötigen. Lediglich für das Warmwasser springt die Wärmepumpe dann immer mal wieder an. Im Winter hingegen bringt die Wärmepumpe Höchstleistungen, die Balkonkraftwerke jedoch nicht. Hier muss die Heizung dann fast ihren gesamten Strom aus dem Netz beziehen.
Problem 3: Balkonkraftwerk an Wärmepumpe anschließen
Ein weiteres Problem stellt die technische Zusammenarbeit zwischen den beiden Systemen dar. Denn Wärmepumpen können auf unterschiedliche Weise ans Stromnetz angebunden werden. Das hängt in der Regel von der Größe der Pumpe ab und ob man einen eigenen Stromzähler benötigt – etwa für Förderungen, Rabatte und genaue Abrechnungen.
Der einfachste Fall wäre es, wenn das Haus über nur einen Zähler verfügt, an dem auch die Wärmepumpe hängt. Damit könnte der Balkon-Strom von allen Geräten genutzt werden, egal ob es sich dabei um den Fernseher oder die Wärmepumpe handelt.
Schwieriger wird es, wenn die Wärmepumpe eine eigene Zuleitung mit eigenem Stromzähler besitzt. Dann kann die Wärmepumpe ihre Energie ausschließlich aus dem Stromnetz beziehen. Wer dennoch ein Balkonkraftwerk anschließen möchte, der müsste eine eigene Schuko-Steckdose in die Wärmepumpen-Leitung legen lassen. An diese käme dann das Balkonkraftwerk. Das ist aber aufwendig, mit weiteren Kosten verbunden und hätte nur einen minimalen Effekt. Denn die ersten beiden Probleme blieben weiterhin bestehen.
Alternative zum Balkonkraftwerk: Nutze einen PV-Heizstab
Ein Balkonkraftwerk und eine Wärmepumpe arbeiten also nicht so gut zusammen, wie von manchen erhofft. Es gibt aber eine gute und kostengünstige Alternative: ein PV-Heizstab.
Viele Wärmepumpen nutzen Pufferspeicher für das Heizwasser, die sich nachträglich mit einem Heizstab bestücken lassen. Es gibt Modelle, die eigene MC4-Anschlüsse besitzen wie beispielsweise der von Fothermo. Dadurch lassen sich einzelne Solarmodule direkt mit dem Heizstab verbinden. Scheint die Sonne, wärmt der Heizstab das Wasser auf.

Zwar arbeiten Heizstäbe nicht so effizient wie eine Wärmepumpe, sie können aber beim Heizen unterstützen und je nach Einstellung dafür sorgen, dass die Pumpe seltener anspringen muss. Da der Strom für den Heizstab von den eigenen Modulen kommt, fallen dadurch keine extra Stromkosten an (Installationskosten aber schon).
Weil die einzelnen Module ausschließlich für den Heizstab installiert werden und weder ins öffentliche Stromnetz noch ins Hausnetz einspeisen können, gelten sie nicht als PV-Anlagen oder Balkonkraftwerke. Das heißt, du kannst zusätzlich noch eine Mini-PV-Anlage im Haus nutzen.
Fazit
Auch wenn sie nach einem Traumpaar klingen, Balkonkraftwerke und Wärmepumpen arbeiten aneinander vorbei. Die kleinen Solaranlagen produzieren immer dann am meisten Strom, wenn die Wärmepumpe keinen benötigt. Und wenn die Heizung dann doch mal anspringt, hat sie einen so großen Hunger auf Energie, dass ein Balkonkraftwerk kaum etwas beitragen kann. Zudem gibt es technische Herausforderungen, wenn die Wärmepumpe einen eigenen Anschluss besitzt.
Dennoch lohnt sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks, da es die Grundlast decken kann und auch für anderen Geräte Strom liefert. Wenn dann mal die Wärmepumpe anspringt und etwas vom eigenen Solarstrom abbekommt, ist das natürlich auch gut. Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde hilft, Stromkosten zu sparen. Nur würde sich die Balkonkraftwerk-Anschaffung ausschließlich für eine Wärmepumpe nicht rentieren. Effizienter wären PV-Heizstäbe mit eigenen Modul-Anschlüssen.