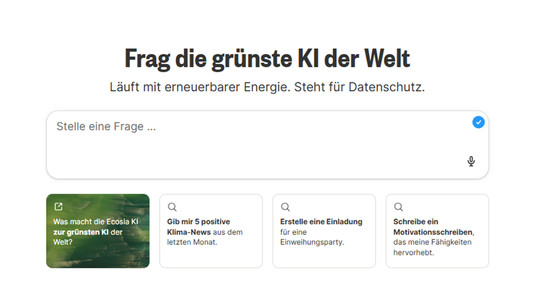Vor der Fischtheke im Hofladen der StadtFarm bildet sich eine Schlange. Es gibt in dem Gewächshaus in Berlin-Lichtenberg afrikanischen Raubwels zu kaufen. Filet, geräuchert, gebeizt und tiefgefroren als Fisch-Bratwurst. Links neben der Fischtheke schwimmen junge Welse in einem kleinen, durchsichtigen Schau-Bassin. Zehn Meter weiter, am Ende des Gewächshauses, drängen sich die ausgewachsenen Brocken mit einem Schlachtgewicht von 1,5 Kilo in einem großen, blauen, abgeschlossenen Tank.
Es gibt hier auch selbst produzierte Salate, Kräuter, Gurken, Tomaten, Papayas und Bananen zu kaufen – gezüchtet mit den Ausscheidungen der afrikanischen Fische. Anne-Kathrin Kuhlemann lehnt an den blauen Fisch-Tanks. Sie erzählt, dass sie gerade dabei sind, das ganze Tier zu verarbeiten. 50 Prozent des Fisches sind essbar, sie experimentieren mit Fischhaut als Lederersatz. Aus dem Rest wird Katzenund Hundefutter. „Die lieben es“, sagt sie.
Urbane Selbstversorgung: Aquaterraponic in Herzberge
Kuhlemann ist Geschäftsführerin der TopFarmers GmbH, die die StadtFarm im Landschaftspark Herzberge im Berliner Osten betreibt. Vor zehn Jahren hat die Betriebswirtin mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar diesen Kreislauf aus Fisch- und Gemüsezucht begonnen. Aquaterraponik heißt das lizensierte Verfahren. Die Kräuter, Salate und Gemüsesorten werden mit den ausgeschiedenen Nährstoffen der Fische versorgt, das Wasser wird von Pflanzen und Erde gefiltert und gereinigt – und wieder zurückgeleitet zu den Fischen. „Unseres Wissens nach ist es der einzige geschlossene Wasserkreislauf in kommerziellen Anlagen der Welt“, sagt sie. 450 000 Euro Umsatz im Jahr macht sie mittlerweile mit diesem Wasserkreislauf. Es gibt an einem Samstag im Monat einen Markt, der Hofladen hat unter der Woche auf, verkauft werden Fischboxen und Gemüseboxen.

Im Corona-Lockdown versiegte allerdings eine Einnahmequelle: die Gastronomie. Doch Anne-Kathrin Kuhlemann glaubt: „Corona verändert das Bewusstsein, weil klar wurde, wie verletzlich die weltweiten Kreisläufe von Lebensmitteln sind.“ Sie sagt: „Ich will Globalisierung nicht abschaffen und zurück in die Höhle, aber wir müssen darüber nachdenken, woher die Produkte kommen. Ob der Apfel aus Neuseeland und die Hirse aus China notwendig sind.“
Berlin hat sich zum Hotspot für Landwirtschaft in der Stadt entwickelt. Die Prinzessinnengärten am Moritzplatz in Kreuzberg sind der Inbegriff für diese Ansätze der urbanen Selbstversorgung: Urban Gardening, Hydroponik, Aquaponik. Hier gibt es auch Vertical Farming – Gewächshochhäuser. Solch teils hoch-technologisierte Projekte gibt es mittlerweile im ganzen Land: Aquaponik in Wuppertal. In München oder Berlin werden in Mini-Gewächshäusern für den Supermarkt oder für zu Hause Salate oder Kräuter über Nährlösungen und ohne Erde gezüchtet. Und was ist mit exotischen Pflanzen wie Papaya, Kakao oder Guave? Die kommen vom Land. In Kleintettau an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze nutzen sie in einem riesigen Tropenglashaus die Abwärme der ortsansässigen Glasbläserwerke und bauen exotische Früchte an.
Retten solche Farming-Projekte jetzt die Welternährung? Kuhlemann winkt zunächst ab: „Wir versorgen ein paar hundert Haushalte mit Fleisch und Gemüse.“ Das sei der Bedarf, den man mit den 50 Tonnen Fisch und den 30 Tonnen Gemüse pro Jahr abdecken könne. Doch sie sagt auch: „Wir wollen 100 StadtFarmen in 10 Jahren hochziehen.“ Im Herbst soll das zweite Glashaus in Berlin eröffnen – in der Rummelsburger Bucht auf dem Gelände des Energiekonzerns Vattenfall.
Die Coronakrise könnte diese lokalen Lebensmittelprojekte und regionalen Lieferstrukturen tatsächlich befördern. In den vergangenen Wochen wurden viele Umfragen zum Konsumverhalten der Deutschen durchgeführt. Vom Nachhaltigkeitsportal utopia.de bis hin zur Strategieberatung Oliver Wyman. Das Ergebnis: Eine Mehrheit der befragten Konsumenten will für Essen deutlich mehr Geld ausgeben als bisher. Die Konsumenten wollen vor allem regionaler einkaufen und sich ökologischer und gesünder ernähren. Und sie wollen mehr selber machen. Neben Klopapier waren zu Beginn der Coronakrise als erstes Brotbackmaschinen ausverkauft.
Massive Landflucht
Dieser Bewusstseinswandel könnte auch noch durch weltweite Entwicklungen von gigantischem Ausmaß notwendig werden. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung von jetzt knapp 8 auf 10 Milliarden Menschen anwachsen, prognostizieren die Vereinten Nationen. Fettleibigkeit wird rasant zunehmen, genauso wie Unterernährung. Es wird eine massive Landflucht einsetzen – fast 70 Prozent der Menschen werden 2050 in Städten leben.
Die Vereinten Nationen heben hier sogar die Chancen hervor: Die zunehmende Konzentration der Bevölkerung in den Städten erlaube es, den ökologischen Einfluss der Menschen auf den Planeten zu reduzieren und Infrastrukturen umweltfreundlicher zu gestalten. Das gilt auch für die Ernährung.
Immer mehr Experten verwenden den Begriff Resilienz im Zusammenhang mit urbanen Ernährungsstrategien. Er bezeichnet die Fähigkeit Krisen zu bewältigen. StadtFarm-Geschäftsführerin Kuhlemann rechnet vor: „Wir kommen mit 80 Prozent weniger Fläche, 85 Prozent weniger Wasser aus und fabrizieren 90 Prozent weniger Treibhausgase.“
Auch auf enorm: Saisonkalender: Wertvoller Dünger aus dem Bokashi-Eimer
Urbane Selbstversorgung: Kann sich Freiburg selbst versorgen?
Wie widerstandsfähig sind also Städte? Sind sie in der Lage, sich selbst zu versorgen? Städte wie Berlin, Hamburg oder Freiburg? Berlin, Hamburg, Freiburg: Es gibt nur drei Studien, die die Frage der Selbstversorgung überhaupt untersuchen. So weit weg ist diese Frage für Politik und Wirtschaft. Freiburg ließ eine Bestandsaufnahme machen zum Grad der Selbstversorgung im gleichnamigen Regierungsbezirk – es ist die einzige in Deutschland überhaupt. Zu Hamburg und Berlin mit ihren angrenzenden Landflächen gibt es mathematische Berechnungen und Prognosen.

Urbane Selbstversorgung in den Städten ist gering. Im überschaubaren Freiburg deckt die Region gerade mal 20 Prozent des Lebensmittelbedarfs ab, ermittelte das Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Bei einer besseren Ausschöpfung des Potenzials regionaler Produkte – aus konventionellem wie ökologischem Anbau – wäre eine komplette Versorgung aus der Region allenfalls bei Produkten wie Milch oder Rindfleisch möglich, nicht aber bei anderen Grundnahrungsmitteln wie Obst oder Gemüse. Die Studien zu Hamburg und Berlin fragen: Könnten sich die Metropolen regional und ökologisch ernähren? Beide Studien sagen: Ja. Theoretisch. Sie berechnen den Nahrungsmittelbedarf eines Einwohners und setzen diesen mit den zur Verfügung stehenden Flächen in Relation. So benötigen die knapp 10 Millionen Einwohner Berlins und Brandenburgs eine Agrarfläche von 12 500 Quadratkilometern. Zur Verfügung stehen 14 600 Quadratkilometer an Nutzflächen. In der Studie heißt es: Momentan wird nicht mal die Hälfte der Flächen bewirtschaftet.
Flächenfresser und Essensmüllvermeidung
Für Hamburg kommt die Studie der HafenCity Universität zum gleichen Ergebnis: Die Bauern im Umkreis von 100 Kilometern könnten die Einwohner der Hansestadt ernähren. Sie weist darauf hin, dass diverse Ernährungsstile zu ganz unterschiedlichem Flächenverbrauch führen. So reicht die Fläche nicht aus, wenn sich die Menschen ausschließlich ökologisch ernähren – aber ihren Fleischkonsum nicht mindern wollen. Ökologische Fleischproduktion ist ein Flächenfresser.
Die Studie zu Berlin nennt noch einen Faktor, der für die Umstellung auf Regio und Bio spricht: Essensmüllvermeidung. 17 Prozent der Waren werden bisher schon während der Produktion und des Handels vernichtet, 14 Prozent noch in den Haushalten. Kurze Lieferketten würden den Abfall reduzieren.
Die Bedingungen für die ökologische urbane Selbstversorgung sind also vor allem zwei: Trotz aller städtischen Gardening-Projekte geht erstens nichts ohne die Anbindung der Region. Zweitens geht es nur über die Umstellung des Konsums. Also: Fleischverzicht.
So einfach ist das? „Das sind theoretische Modelle“, sagt Timo Kaphengst. Er ist Sprecher des Berliner Ernährungsrats. Seit 2016 gibt es das zivilgesellschaftliche Gremium als eines der ersten in Deutschland. Der Rat will die Ernährung in Berlin ökologischer und gerechter gestalten. „Es braucht eine komplette Veränderung der Agrarstruktur“, sagt Kaphengst, der auch Geschäftsführer der Regionalwert AG ist, die regionale und ökologische Erzeuger unterstützt. Er meint das ganz konkret: Es brauche zum Beispiel mehr Kartoffelanbau, den es in Brandenburg trotz des großen Bedarfs viel zu wenig gibt. Es fehlen Schlachthöfe in Brandenburg, um die Tiere direkt verarbeiten zu können. „Die Politik kann Ziele formulieren und Strukturen schaffen, die über die Legislaturperiode hinausgehen“, sagt Kaphengst. Er nennt ein Beispiel: Der rot-rotgrüne Senat hat den Etat 2020/21 für seine neue Ernährungsstrategie verabschiedet. 2,9 Millionen Euro gibt es dafür. 2,8 Millionen Euro gehen in das Fortbildungsprojekt „Kantine der Zukunft“, das vom „House of Food“ in Kopenhagen inspiriert ist. Küchenteams öffentlicher Einrichtungen sollen so für Regio und Bio gewonnen werden. Gerade über öffentliche Ausschreibungen könne der Staat Druck auf die Produktionsweisen ausüben, sagt Kaphengst, er findet deshalb die „Kantine der Zukunft“ auch „okay“, wie er sagt, selbst wenn Berlin nicht wie Kopenhagen auf 100 Prozent Bio in Schulkantinen umstelle, sondern nur auf 50 Prozent. „Bio ist super, Nachfrage erhöhen ist super“, sagt Kaphengst, „aber dann muss ich auch dafür sorgen, dass die regionalen Strukturen mitwachsen.“
Anbindung der Region. Veränderung der Essgewohnheiten. Eine nachhaltige Agrarreform für die Region wäre also die dritte Bedingung für die ökologische Selbstversorgung der Städte.
Auch auf enorm: Online Kochen: „Restlos glücklich“ mit der digitalen Zero-Waste-Küche
Urbane Selbstversorgung: Verdoppelter Umsatz seit Corona
Im Hausdurchgang des Altbaus in der Barbarossastraße 6 in Berlin-Schöneberg werden die letzten Markttische aufgestellt. Wie jeden Dienstag gegen 17.30 Uhr. Karin Moehl und Beate Klein wohnen hier. Sie begutachten, ob die Papier-Einkaufstüten mit den richtigen Nummern versehen und schon alle Bestellungen verpackt sind. Nummer 28: 10 Artenschutz-Hühnereier und Sauerkirschmarmelade vom Walter-Hof in Altlandsberg; Filet vom Bio-Lamm und Bio-Lamm-Koteletts vom Milchschafhof Streganz Berg in Heidesee; 1 Kilo Möhren und 1 Kilo Linda-Kartoffeln vom Obst- und Gemüsehof Teltower Rübchen in Teltow.
„Seit Corona hat sich der Umsatz verdoppelt“, sagt Karin Moehl. Sie und Beate Klein, die eine Event-Agentur betreibt, und Agile Coachin ist, organisieren die Marktschwärmer von Schöneberg. So heißt eine Initiative, die in Frankreich erfunden wurde. Es ist wie im Mittelalter. Die Bauern aus Brandenburg liefern einmal pro Woche ihre Waren in die Stadt. Nur gab es im Mittelalter kein Internet. Bestellt wird auf marktschwaermer.de – bis Sonntagabend geht das. Und zwei Tage später liefern die Biobauern ihre Ware. Die Fuhre ist für die Erzeuger planbar. „Geerntet wird, was bestellt wurde“, sagt Klein. Wenn so wenig bestellt werde, dass sich die Anfahrt nicht lohne, werde nicht geliefert. „Wir sind kein Supermarkt, wo alles immer verfügbar ist – in fünffacher Auswahl“, sagt Klein.
Keine Zwischenhändler
Die Marktschwärmer sind ein bundesweites Netzwerk. Es folgt dem Prinzip der Direktvermarktung. Es gibt keine Zwischenhändler. Es gibt immer mehr Kunden, die regional und ökologisch einkaufen. In Berlin gibt es 18 Marktschwärmereien mit 24 000 Mitgliedern. Bundesweit sind es 73 Marktschwärmereien, 59 befinden sich im Aufbau. In Nürnberg, in Bremen, in Feyen oder in Riesa. Die Gastgeberinnen bekommen 8,35 Prozent des Umsatzes. Es ist nicht mehr als eine kleine Aufwandsentschädigung. Durch die verdoppelte Nachfrage wegen Corona ist diese zuletzt immerhin etwas gestiegen.
Doch das ist nicht die Motivation. „Ich will wissen, was ich konsumiere“, sagt Beate Klein. Sie kenne fast jeden Produzenten. „Man baut Vertrauen auf und benötigt keine Siegel.“ Es sei eine alternative Form des Einkaufens. „Ich versorge meine Familie fast nur noch über unsere Brandenburger Bauern.“ Beate Klein erfüllt also alle Bedingungen zur regionalen, ökologischen Selbstversorgung. Sie bezieht die Produzenten der Region mit ein. Sie fördert damit nachhaltigere Strukturen in der Landwirtschaft. Fleischverzicht? Von Bevormundung beim Essen halte sie gar nichts. „Wir essen jeden Tag Wurst oder Fleisch“, sagt sie, „nur teilen wir das Paar Bio-Knacker jetzt durch fünf.“
Dieser Text erschien zuerst im Fokus „Lebensmittel“ in der aktuellen Ausgabe des enorm Magazins. Autor: Thilo Knott
** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.