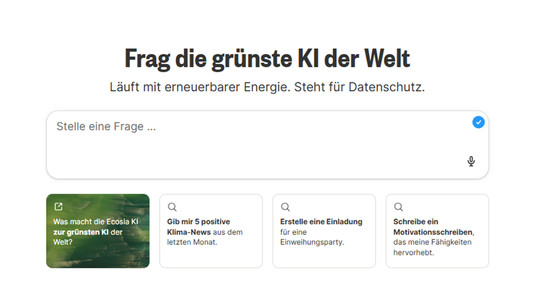Die einen sprechen von einem echten Durchbruch für mehr Menschenrechte, die anderen beklagen es als faulen Kompromiss: Der Bundestag hat am 11. Juni das viel diskutierte Lieferkettengesetz verabschiedet. Wird Wirtschaft dadurch gerechter?
Stammt mein Shirt aus einer Fabrik mit mangelnden Sicherheitsstandards? Wurden die Kakaobohnen meiner Lieblingsschokolade von Kinderhänden geerntet? Gart mein Sonntagsessen in einer Ofenform, deren Eisenerzabbau kostbares Trinkwasser verseucht hat?
Noch immer machen viele international agierende Unternehmen, darunter auch deutsche, hierzulande Gewinne auf Kosten von Mensch und Natur im fernen Ausland – ohne dafür haften zu müssen. Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Lieferkettengesetz soll dies ändern.
Was bewirkt das Lieferkettengesetz?
Das Lieferkettengesetz soll Schluss machen. Schluss mit Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen. Schluss mit „freiwilligen, unternehmerischen Selbstverpflichtungen“ – denn die Erfahrung hat gezeigt: wenn es in der Wirtschaft um mehr Transparenz und Fairness geht, reicht Freiwilligkeit nicht aus. Im Zweifelsfall entscheidet leider nach wie vor meist der Preis darüber, woher und zu welchen Bedingungen Unternehmen Produkte und Rohstoffe einkaufen.
Mit dem Lieferkettengesetz werden einige Firmen nun dazu verpflichtet, auch im Ausland ökologische und soziale Mindeststandards durchzusetzen. Das bedeutet: weg von rein freiwilliger Corporate Social Responsibility hin zu verbindlichen Sorgfaltspflichten. Daher heißt das Gesetz auch offiziell „Sorgfaltspflichtengesetz“. Betroffene Unternehmen müssen künftig:
- regelmäßige Risikoanalysen durchführen
- entsprechende Berichte vorlegen, die ihre Bemühungen in Sachen Menschenrechte und Umweltschutz belegen
- eine Grundsatzerklärung ihrer unternehmerischen Menschenrechtsstrategie verabschieden
- Präventionsmaßnahmen und Beschwerdemechanismen für Betroffene einrichten
Das Lieferkettengesetz gilt zunächst nur für Unternehmen ab 3000 Beschäftigten
Das Gesetz gilt ab 2023 für Unternehmen ab 3000 und ein Jahr später für Firmen ab 1000 Beschäftigen. Damit trifft es in den ersten beiden Jahren nur rund 3500 deutsche Firmen – das entspricht nicht einmal 1% der insgesamt über 3 Millionen deutschen Firmen und nur 23% der deutschen Großunternehmen. Denn laut Handelsgesetzbuch gelten bereits Unternehmen ab 250 Mitarbeitern als „groß“. Immerhin erfasst das Gesetz auch ausländische Unternehmen, deren deutsche Zweigniederlassungen die oben genannte Mitarbeiterzahl erreichen.
Eine Klausel, nach der auch kleinere Unternehmen sogenannter Risikobranchen – etwa dem Textil-, Chemie- oder Lebensmittelsektor – zumindest teilweise gesetzlich in die Pflicht genommen werden sollen, wurde trotz heftiger Kritik nicht mit aufgenommen. „Das ist ein Problem“, findet Maren Leifker von Brot für die Welt. „Unternehmen aus Branchen, in denen das Risiko für menschenrechtliche Verletzungen besonders hoch ist, sollten zumindest dazu verpflichtet werden, regelmäßige Risikoanalysen durchzuführen“, fordert sie.

Abgestuft: Gesetz erfasst nur direkte Zulieferer
Ebenfalls in der Kritik steht die Regelung, für wie viele Stufen einer Lieferkette ein Unternehmen haftbar gemacht werden kann. Denn internationale Beschaffungswege sind oft komplex und gleichen statt Ketten eher weit verzweigten Netzwerken, in denen sich eine Vielzahl an Zulieferern, Produzenten und Händlern tummeln. Nicht jedes Unternehmen hat eigene Tochtergesellschaften im Ausland und damit die Möglichkeit, die Bedingungen vor Ort direkt zu beeinflussen.
Das Gesetz legt deshalb fest, dass die neuen Sorgfaltspflichten nur für direkte Zulieferer gelten sollen. Folglich wäre beispielsweise ein deutsches Textilunternehmen zwar verantwortlich für das, was in einer Schneiderei im Ausland vor sich geht, jedoch nicht für das, was zuvor in der Lieferkette geschieht – bei den Baumwollproduzenten, in Spinnereien, Webereien oder Färbereien. Dabei ist bekannt, dass ein Großteil der Menschenrechtsverletzungen gerade am Beginn der Lieferketten, also im Bereich der mittelbaren Zulieferer, zu verzeichnen ist.
Damit deckt das Gesetz lediglich einen Bruchteil einer Lieferkette – vielmehr nur ein einziges Lieferkettenglied – ab. „Nur für den Fall, dass Unternehmen bereits ‚substantiierte Kenntnis‘ über mögliche menschenrechtliche Verletzungen bei ihren mittelbaren Zulieferern haben, müssen sie eine entsprechende Risikoanalyse durchführen“, ergänzt Maren Leifker. Wenn Firmen also wissen, dass etwas faul ist, müssen sie genauer hinschauen – und das soll ein Durchbruch sein?
Keine zivilrechtliche Haftung
Auch in der Frage, wie Unternehmen für Menschenrechtsverstöße und Umweltsünden haftbar gemacht werden sollen, gibt es viele enttäuschte Gesichter. Die neuen Pflichten sollen behördlich, nämlich vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), durchgesetzt werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder sowie der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen.
Doch auch in Zukunft können Betroffene im Ausland nicht vor deutschen Gerichten Schadenersatz einklagen, wenn etwa eine Fabrik aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards niederbrennt oder ganze Lebensräume mit Chemikalien vergiftet werden. Privater Schadenersatz ist nicht vorgesehen. Lediglich NGOs und Gewerkschaften, die in Deutschland registriert sind, können im Namen der Betroffenen klagen.
Und was ist mit der Umwelt?
Die Formulierungen in Sachen Umweltschutz kommen sehr bürokratisch-kompliziert daher. Umweltbezogene Pflichten beziehen sich dabei speziell auf Quecksilberemissionen sowie auf die negativen Folgen „persistenter organischer Schadstoffe“. Dabei handelt es sich laut Umweltbundesamt um „organische Chemikalien, die sich durch ihre Langlebigkeit (Persistenz) auszeichnen, sich in der Nahrungskette anreichern, schädliche Wirkungen auf den Organismus von Mensch und Tier zeigen und die über ein Potential zum weiträumigen Transport verfügen“. Dazu gehören unter anderem giftige Pflanzenschutzmittel, aber auch verschiedene Industriechemikalien.
Die sich folglich ergebenden Pflichten zum Umweltschutz zielen fast ausschließlich auf den Schutz der menschlichen Gesundheit ab und „sollen nur dann gelten, wenn durch ihre Missachtung Menschenrechte verletzt werden“, gibt Maren Leifker zu Bedenken. Massive Umweltzerstörungen durch Biodiversitätsverlust und Auswirkungen auf das Klima werden nicht erfasst.
Welche Auswirkungen hat das Lieferkettengesetz auf uns Konsumenten?
Eines muss klar sein: Das Lieferkettengesetz wird Firmen Geld kosten. Maßnahmen vor Ort für höhere Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie der bürokratische Aufwand für Analysen und Berichte müssen bezahlt werden. Wie bereits bei Bio- und Fair-Trade-Produkten üblich, würde der Zusatzaufwand vermutlich durch höhere Preise an die Konsumenten weitergegeben. Vor allem bei Risikoprodukten wie Leder oder Textilien müssten wir also mit Preissteigerungen rechnen – zunächst jedoch nur dann, wenn diese von Großunternehmen stammen.
Fazit:
Das Lieferkettengesetz, so verwässert es vielen in seiner letztlichen Ausgestaltung auch vorkommen mag, leitet in Sachen unternehmerische Verantwortung einen längst überfälligen Paradigmenwechsel ein. Alleine die Tatsache, dass sich Großunternehmen künftig verpflichtend damit auseinandersetzen müssen, welche menschenrechtlichen Risiken ihre Lieferketten bergen, ist ein Schrittchen in die richtige Richtung. Dennoch wäre es wünschenswert, dass sowohl die Zahl der Unternehmen, die durch das Gesetz in die Pflicht genommen werden, als auch die Zahl der zu betrachtenden Stufen in der Lieferkette erhöht werden. Umwelt- und klimabezogene Aspekte steift das Gesetz gar nicht oder nur sehr oberflächlich. Wem die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards wirklich am Herzen liegt, ist nach wie vor mit Bio- und Fair-Trade-Produkten am besten bedient.
Weiterlesen auf Utopia.de:
- Blockchain for good: kryptische Technik kann die Welt verbessern
- Diese 15 Dokus muss man gesehen haben
- Good life goals: So trägst du zu einer nachhaltigen Entwicklung bei