Eine Hitzeglocke ist mehr als nur eine einfache Hitzewelle. Was dieses Wetterphänomen so gefährlich macht und inwieweit es auch in Europa zunehmend an Bedeutung gewinnt, erfährst du hier.
Sommerliche Hitze kennt jede:r, doch wenn sich heiße Luftmassen tagelang festsetzen und nicht mehr aufsteigen und abkühlen können, sprechen Meteorolog:innen von einer Hitzeglocke – oder einer Hitzekuppel bzw. Heat Dome. Dieses Wetterphänomen führt zu Tagen mit extremer Hitze, Trockenheit und tropischen Nächten. Die Folgen: erhöhte Waldbrandgefahr, höhere Sterblichkeit sowie psychische und körperliche Risiken.
Wie entsteht eine Hitzeglocke?
Eine Hitzeglocke bildet sich, wenn sich warme Luft in einer Region sammelt und darüber ein ausgedehntes Hochdruckgebiet entsteht. Das Hochdruckgebiet drückt die warmen Luftmassen zur Erdoberfläche und verhindert, dass diese entweichen können oder von außen kalte Luft einströmt. Die Hitze ist sozusagen „gefangen“.
Durch den Druck und die Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Luftmassen noch stärker. Gleichzeitig werden Niederschlag und Wolkenbildung verhindert. Eine solche Hitzekuppel kann nur wenige Tage, aber auch mehrere Wochen anhalten.
Dass sich ein Hochdruckgebiet so stark in einer Region festsetzen kann, hängt häufig mit dem Jetstream zusammen. Der Jetstream ist ein starkes Windband in der oberen Atmosphäre, das normalerweise Wetterlagen wie Hochs und Tiefs über die Kontinente bewegt. Werden die Winde kurvenreicher, verlangsamt sich der Jetstream und kann sogar völlig still stehen. In diesen Windströmen können sich Hochdruckgebiete regelrecht festsetzen.
Klimakrise: Mehr Hitzeglocken in Europa?
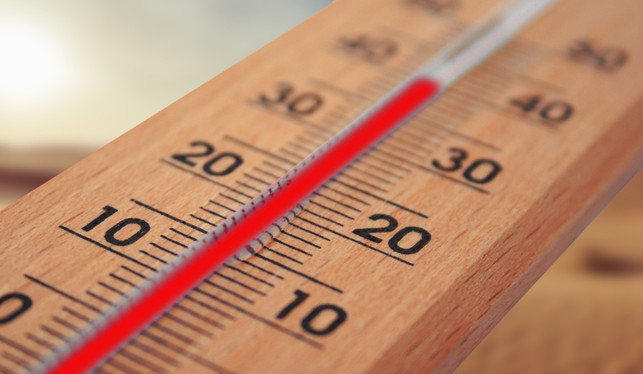
Inwieweit die Klimakrise die Entstehung von Hitzeglocken begünstigt, ist bislang noch ungeklärt. Fakt ist aber, dass der fortschreitende Klimawandel Hitze und extreme Wetterereignisse begünstigt. Zudem kommt eine Studie von 2023 zu dem Schluss, dass Hitzeglocken wahrscheinlicher werden, je stärker sich die Erde erwärmt.
Seit den 2020er-Jahren hat das Wetterphänomen insbesondere in Nordamerika zugenommen. Hier entstehen Hitzeglocken in den Sommermonaten mittlerweile regelmäßig. Im Jahr 2023 stellten Meteorolog:innen auch in Südeuropa eine Hitzeglocke fest. Damals wurden in Regionen in Griechenland, Spanien und Italien Temperaturen von über 45 Grad gemessen.
Doch nicht jede Hitzewelle ist gleich als Hitzeglocke einzustufen. Solange kein ausgedehntes Hochdruckgebiet vorliegt, das die warmen Luftmassen einschließt, sprechen Expert:innen nicht von einer Hitzekuppel.
Hitzeglocken: Darum ist extreme Hitze ein Problem
Extreme Hitzewellen, wie sie auch als Folge von Hitzeglocken entstehen können, sind insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen lebensgefährlich. In den Sommern 2023 und 2024 gab es in Deutschland jeweils etwa 3.000 Hitzetote.
Eine jüngst veröffentlichte Studie untersuchte zudem die Auswirkungen der Hitzewelle im Juni und Juli 2025. Sie kam zu dem Schluss, dass die Klimakrise diese Hitzewelle so stark verstärkte, dass es dreimal so viele Hitzetote gab. So führten die Forschenden in den untersuchten zwölf Städten insgesamt 1.500 Todesfälle auf die durch die Klimakrise stark erhöhten Temperaturen zurück. Die Wissenschaftler:innen beschreiben Hitze dabei als „lautlosen Killer„, da viele Hitzetote nicht als solche gemeldet würden und es lange dauere, bis die Daten gesammelt und veröffentlicht würden.
Hitzeglocken begünstigen zudem Trockenheit und können so Waldbrände auslösen. Außerdem kann langanhaltende Hitze auch für Personen, die nicht zur Risikogruppe gehören, körperliche Folgen haben. Dazu zählen etwa:
- Schwindel, Kopfschmerzen und Benommenheit
- verringerte Leistungsfähigkeit und Erschöpfung
- Hautausschläge
- Schwellungen in den Beinen und Wadenkrämpfe
- Schlaflosigkeit in Tropennächten
Nicht zuletzt leidet auch unsere Psyche im Sommer, denn starke Hitzeperioden können psychische Erkrankungen auslösen oder bestehende Krankheitsbilder verschlimmern.
Schutz vor Hitze: Verhalten bei Hitzeglocken

Sollte es eine Hitzeglocke über Deutschland geben oder befindest du dich in einer Region, in der sich gerade eine Hitzeglocke gebildet hat, ist es wichtig, Körper und Psyche vor den hohen Temperaturen zu schützen:
- Trinke ausreichend Wasser, auch wenn du keinen Durst hast. Der Flüssigkeitsbedarf steigt bei Hitze stark an – mindestens zwei bis drei Liter am Tag sollten es sein, vorzugsweise Wasser oder ungesüßter Tee. Isotonische Getränke können sich bei Hitze sogar besser eignen als Wasser.
- Vermeide körperliche Anstrengung in der Mittagshitze, besonders zwischen 11 und 17 Uhr. Sport, Gartenarbeit oder lange Wege solltest du in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegen. Die Tageszeit zwischen 17 und 18 Uhr ist oft übrigens am heißesten.
- Halte deine Wohnung kühl, indem du Fenster und Rollläden tagsüber geschlossen hältst und erst abends oder nachts lüftest. Es kann auch helfen, nasse Handtücher aufzuhängen, um die Raumtemperatur zu senken.
- Trage helle, luftige Kleidung aus Baumwolle oder Leinen. Kopfbedeckungen und Sonnenbrillen schützen im Freien vor Überhitzung und UV-Strahlung.
- Achte auf leichtes Essen, zum Beispiel Obst, Gemüse und kleine Mahlzeiten. Schweres, fettiges Essen belastet den Kreislauf zusätzlich. Alkohol ist bei Hitze grundsätzlich keine gute Idee.
- Achte auf gefährdete Personen in deinem Umfeld – ältere Menschen, Kinder, Schwangere oder chronisch Kranke reagieren besonders empfindlich auf Hitze. Ein kurzer Anruf oder Besuch kann lebensrettend sein.
- Bei Anzeichen von Hitzestress wie Schwindel, Übelkeit oder Verwirrtheit: Begib dich sofort in den Schatten oder einen kühlen Raum und hole notfalls ärztliche Hilfe.
















