Viele Menschen in Deutschland werden wegen ihrer sozialen Herkunft diskriminiert, sagt Natalya Nepomnyashcha – vor allem im beruflichen Kontext. Sie selbst hat das jahrelang erlebt. Im Utopia-Interview erklärt sie was den sozialen Aufstieg erschwert – und warum Menschen aus ärmeren Verhältnissen sehr gute Arbeitnehmer:innen sind.
Orange unterstrichene oder mit ** markierte Links sind Partnerlinks. Wenn du darüber bestellst, erhalten wir einen kleinen Anteil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.
Natalya Nepomnyashcha ist in einer Familie aufgewachsen, die auf Hartz IV angewiesen war. In Schule und Beruf wurde sie deshalb oft unterschätzt. Mittlerweile hat sie den Aufstieg in die Bussinesselite geschafft und arbeitet als Beraterin für EY. Mit dem Netzwerk Chancen hilft sie Menschen, die den sozialen Aufstieg anstreben. Um die Hindernisse geht es auch in ihrem neuen Buch „Wir von unten“. Im Interview mit Utopia spricht sie über die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft und wie sich das System ändern ließe.
Natalya Nepomnyashcha: Chancengleichheit betrifft uns alle
Utopia: „Wenn Sie auf ein Gymnasium gehört hätten, wären Sie schon auf einem“: Mit diesem Satz hat der Konrektor eines Gymnasiums, auf das Sie wechseln wollten, diesen Wechsel verhindert – und somit auch Ihr Abitur. Was macht das heute mit Ihnen, wenn Sie an diesen Satz zurückdenken?
Melde dich kostenlos an und lies weiter.
Jetzt kostenfrei registrieren- kostenfreies MeinUtopia-Konto
- alle Premium-Artikel gratis
- exklusive Angebote von unseren Partnern
Natalya Nepomnyashcha: Damals habe ich das einfach akzeptiert. Ich habe so viel Ablehnung erfahren und dachte tatsächlich, dass ich nicht gut genug bin. Dass alle Menschen, die auf das Gymnasium dürfen, einfach klüger sind als ich. Nachdem ich viel reflektiert und gelesen hatte, habe ich irgendwann verstanden, dass der Fehler im System liegt. Aber das hat Jahre gedauert. Wenn ich heute an diesen Satz zurückdenke, macht er mich wütend. Aber eher für die kleine Natalya von damals als für mich heute. Und natürlich auch für die ganzen Kinder, denen das heute noch passiert.
Utopia: Man könnte sagen, das hat die soziale Gerechtigkeit zu Ihrem Herzensthema gemacht.
Nepomnyashcha: Ja, insbesondere das Thema Chancengleichheit. Es geht mir hauptsächlich darum, dass Menschen aus ärmeren Verhältnissen wie ich Chancen bekommen. Chancen, ihre Talente zu entfalten, zu leben und Jobs ergreifen zu können, in denen sie erfolgreich sind. Sozialer Aufstieg wird oft mit Bildungsaufstieg gleichgesetzt, aber das sehe ich nicht so. Mir geht es nicht darum, dass jeder studieren sollte. Mir geht es darum, dass jeder Mensch ungeachtet der Herkunft nach seinen Stärken und Talenten gefördert und nicht einfach in eine Schublade gesteckt wird.
Utopia: In ihrem neuen Buch „Wir von unten“ schreiben Sie deshalb, die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft betreffe uns alle.
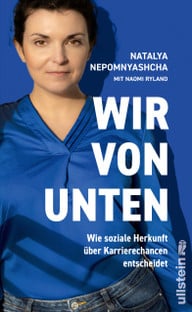
Nepomnyashcha: Genau. Die Kernaussage ist, dass die soziale Herkunft einen enormen Einfluss auf Karriere und Erfolg hat und dass wir uns in Deutschland dieser Tatsache endlich stellen müssen. Wir müssen gemeinsam etwas dagegen tun – und zwar sowohl die Menschen, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, als auch privilegierte Menschen. Diese können sich uns nämlich anschließen und ihre Privilegien teilen.
Utopia: Allerdings ist der Glaube, wir hätten in Deutschland längst Chancengleichheit, weit verbreitet. „Wenn man nur hart genug arbeitet, dann kann man alles schaffen“, heißt es. Begegnet Ihnen diese Einstellung oft?
Nepomnyashcha: Ja absolut. Interessanterweise kommt das von zwei Seiten. Einerseits von Menschen, die den sozialen Aufstieg geschafft haben. Diese denken oft, wenn Sie das konnten, können andere es auch. Und auf der anderen Seite von Menschen, die privilegiert aufgewachsen sind. Sie wollen sich oft nicht eingestehen, dass der Erfolg auch auf Herkunft und Glück basiert – nicht nur auf individueller Leistung.
Nepomnyashcha: „Mehrgliedrigkeit des Schulsystems ist Hindernis für sozialen Aufstieg“
Utopia: Sie schreiben in Ihrem Buch, der soziale Aufstieg werde systematisch erschwert. Wodurch?
Nepomnyashcha: Die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems ist für mich das größte Hindernis für den sozialen Aufstieg in Deutschland, weil diese so viele Barrieren schafft. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien bei gleichen Fähigkeiten schlechtere Chancen auf eine Gymnasialempfehlung haben. Und wenn diese Kinder kein Abitur machen, können sie auch nicht studieren und kommen vermutlich auch nicht auf die Idee, dass das überhaupt machbar wäre. Natürlich gibt es die Option, das Abitur nachzuholen – aber das ist eine weitere Hürde. Wenn alle auf einer Gemeinschaftsschule wären, würde es diese Brüche gar nicht geben, weil man die Kinder viel individueller fördern würde. Denn die Aufteilung in weiterführende Schulen passiert jetzt viel zu früh, sodass man Talente oft noch gar nicht erkennen kann.
Genauso behindernd sind die Studienkosten – insbesondere, dass das Bafög nicht regional gestaffelt ist. Denn auch wenn das Geld für Kleinstädte oft reichen mag, dann reicht es nicht automatisch für Hamburg, München oder Berlin. Dabei sollte die Entscheidung, wo man studiert, davon abhängen, wo es den besten Studiengang gibt oder wo es die Schwerpunkte gibt, die am besten zu mir passen – nicht von meiner sozialen Herkunft.
Utopia: Und auch beim Berufseinstieg bleiben Hürden.
Nepomnyashcha: Absolut. Studien in anderen Ländern haben gezeigt, dass Menschen aus ärmeren Verhältnissen viel länger nach Jobs suchen müssen und auch der Aufstieg im Beruf viel länger dauert. Die Wahrscheinlichkeit, Führungspositionen zu bekommen, ist viel geringer und sie verdienen auch weniger als andere auf vergleichbaren Positionen.
Förderung von sozialen Aufsteiger:innen
Utopia: Um diese Hürden zu überwinden, haben Sie das Netzwerk Chancen gegründet, mit dem Sie Menschen helfen, diesen sozialen Aufstieg zu schaffen. Wie machen Sie das?
Nepomnyashcha: Beim Netzwerk Chancen fördern wir nicht nur Schulabgänger:innen, sondern hauptsächlich Menschen, die schon ins Berufsleben eingestiegen sind. Denn nur weil man einen Job gefunden hat, heißt das nicht, dass man schon alle Chancen erhalten hat. Deshalb geben wir Workshops zu Themen wie Karriereplanung, Networking, aber auch dazu, wie man mit Excel umgeht. Wir geben auch Einzelcoachings und bieten Mentoring an. Und natürlich Kontakt zu unseren Unternehmenspartner:innen, die schon erkannt haben, dass soziale Herkunft ein Diversity-Faktor ist und am Arbeitsplatz eine Rolle spielt.
Utopia: Sie legen den Fokus also sehr stark auf die Förderung der Menschen aus ärmeren Verhältnissen. Aber liegt das Problem nicht oft bei Arbeitgeber:innen und ihren Vorurteilen?
Nepomnyashcha: Ich glaube es müssen sich beide Seiten aufeinander zu bewegen. Aber natürlich werden aktuell oft lieber Leute eingestellt, die auf einer Top-Uni waren, die Top-Noten haben. Und dazu kommt, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Geschäftsführer:innen suchen sich deshalb gerne „Mini-Me’s“ aus, die sie fördern und denen sie Chancen und gute Projekte geben. Dafür muss man Unternehmen sensibilisieren. Wir sollten in meinen Augen auch über die Einführung einer Quote diskutieren, wie wir sie dank der Frauenbewegung für weibliche Führungskräfte im Vorstand haben. Gleichzeitig kann man auch Menschen aus ärmeren Verhältnissen helfen, indem man ihnen Tipps zu ihrem Auftreten gibt, wie wir das im Netzwerk Chancen tun.
Utopia: Wie kann diese Sensibilisierung von Unternehmen aussehen?
Nepomnyashcha: Zuerst ist das Aufzeigen von Daten wichtig. Denn wenn man diese Daten nicht hat, kann man leicht behaupten, es gebe Chancengleichheit. Die bekannteste Studie aus Deutschland ist von Michael Hartmann. Der hat untersucht, aus welchen sozialen Schichten die CEOs einiger großer deutscher Unternehmen kommen. Er hat herausgefunden, dass 80 Prozent der CEOs aus sehr privilegierten sozialen Verhältnissen stammen, besser gesagt aus den oberen 3,5 Prozent der Bevölkerung. In Frankreich gab es außerdem eine Studie, für die zahlreiche identische Lebensläufe versandt wurden – nur die Postleitzahl war eine andere. Auf die Lebensläufe mit Postleitzahlen in Brennpunktvierteln folgte viel seltener eine Einladung. Und auch durch das Erzählen meiner eigenen Geschichte lassen sich Unternehmen gut sensibilisieren.
Nepomnyashcha: Meine Geschichte ist nicht repräsentativ
Utopia: Sie sind in einer Familie groß geworden, die hauptsächlich von Hartz IV gelebt hat. Mittlerweile verkehren Sie in der Businesselite. Das ist tatsächlich eine sehr beeindruckende Geschichte. Was denken Sie, war der entscheidende Punkt dafür, dass Ihnen der soziale Aufstieg gelungen ist?
Nepomnyashcha: Meine Resilienz. Ich kann ehrlicherweise nicht sagen, woher sie kam. Meine Eltern hatten sie nicht. Sie leben schon sehr lange vom Bürgergeld und waren auch schon in Kyiv arbeitslos, wo ich geboren bin und die ersten elf Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich allerdings habe nach meinem Realschul-Abschluss noch zwei schulische Ausbildungen abgeschlossen und danach meinen Master in England angehängt, obwohl die Finanzierung extrem schwer war. Aber es hat sich gelohnt – ich habe ihn mit Auszeichnung abgeschlossen.
Ich habe aber auch viele Leute auf meinen Weg getroffen: Mentor:innen und Sponsor:innen, die ihr Netzwerk mit mir geteilt haben. Aber was mir persönlich ganz wichtig ist: Meine Geschichte ist nicht repräsentativ. Es gibt so viele, die den sozialen Aufstieg nicht geschafft haben und ihre Geschichten bleiben im Schatten. Dabei sind es ja genau diese Menschen, deren Nöte, Sorgen und Träume mehr Gehör brauchen.
Utopia: Sie sind auch der Meinung, genau diese Menschen seien besonders gute Arbeitnehmer:innen. Warum?
Nepomnyashcha: Sie haben viele Eigenschaften, die sie zu sehr guten Arbeitnehmenden machen, da gibt es Untersuchungen, die das bestätigen. Gründe dafür gibt es viele. Weil wir uns irgendwo durchbeißen mussten und selbst nach ungewöhnlichen Lösungen suchen mussten, sind wir sehr belastbar und kreativ. Dass wir loyal sind, hat wahrscheinlich mit der Dankbarkeit zu tun, überhaupt einen Job zu haben. Und flexibel sind wir, weil wir oft zwischen sozialen Schichten hin und her springen: Im Gespräch mit meinen Eltern spreche ich ganz anders und über ganz andere Dinge als beispielsweise im Gespräch mit Ihnen.
Unterschied zwischen ethnischer und sozialer Herkunft
Utopia: Dennoch werden diese Menschen – wie auch viele andere Gruppen – in der Arbeitswelt weiterhin diskriminiert. Sie sagen allerdings sehr deutlich, es sei ein Problem ethnische und soziale Herkunft in einen Topf zu werfen. Warum?
Nepomnyashcha: Weil es beiden Gruppen nicht gerecht wird. Es gibt Menschen aus ärmeren Verhältnissen, die keinen Migrationshintergrund haben und dann durch alle Raster fallen, weil man die soziale Herkunft nicht als Hindernis anerkennt. Und genauso gibt es Menschen, die Migrationshintergrund haben, die aber ökonomisch privilegiert aufgewachsen sind. Denen hilft man nicht, wenn man versucht, ihnen mehr Geld zu geben. Ihnen hilft es, wenn man Rassismus bekämpft. Deshalb ist es wirklich wichtig, einerseits einzugestehen, dass diese beiden Punkte sich auch überschneiden können, wie bei mir, aber dass Diskriminierung auch unabhängig von der ethnischen Herkunft stattfindet.
Utopia: Das hat ja auch mit dem Stichwort „diversity“ zu tun, das mittlerweile auch sehr gerne von Unternehmen genutzt wird. Ist das eher ein Modewort oder tut sich tatsächlich etwas?
Nepomnyashcha: Es tut sich etwas, aber viel zu wenig. Ich arbeite hauptberuflich als Beraterin für EY und da haben wir vor kurzem im Rahmen einer Studie neun europäische Länder im Hinblick auf den Diversity-Erfolg der Unternehmen untersucht. Deutschland ist auf dem letzten Platz gelandet. Dass soziale Herkunft sich nicht gut darstellen lässt, ist außerdem ein Problem, weil Diversity gerne auf Plakaten und Flyern abgebildet wird. Dadurch bleibt das Thema oft auf der Strecke. Großbritannien ist da schon viel weiter als wir. Viele Unternehmen sind dort eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen, einen bestimmten Anteil von Menschen aus der Arbeiterklasse im Vorstand zu haben. Davon sind wir in Deutschland aber noch weit entfernt.
Utopia: Da könnte man schnell die Hoffnung verlieren. Welchen Tipp geben Sie Menschen, die wegen ihrer sozialen Herkunft diskriminiert werden, um den Aufstieg dennoch zu schaffen?
Nepomnyashcha: Sich Netzwerke suchen, sich nicht verstecken und sich nicht für die eigene soziale Herkunft schämen, denn dafür kann man nichts. Und wenn man an ganz viele Türen klopft, werden ganz viele zu bleiben, aber irgendeine wird aufgehen. Darum sollte man auf jeden Fall weiter klopfen und sich Verbündete suchen. Und auch nie vergessen: Nach jedem Sonnenuntergang kommt ein Sonnenaufgang.
Das neue Buch „Wir von unten“ von Natalya Nepomnyashcha ist online z.B. bei Buch7, Thalia oder Amazon erhältlich.
















