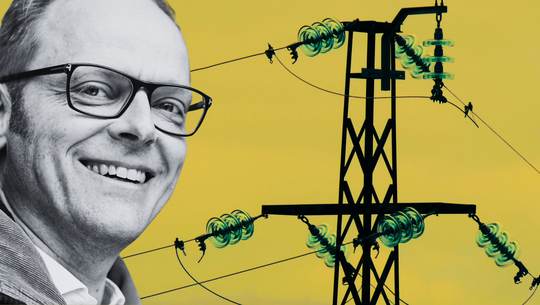Eine neue Wärmepumpe kostet viel Geld – oft unnötig viel. Um überhöhte Kosten zu vermeiden, solltest du schon bei der Planung auf einige Dinge achten.
Wer Glück hat, hat für unter 10.000 Euro eine neue Wärmepumpe im Haus stehen. Wer Pech hat, zahlt 60.000. Untersuchungen wie zuletzt von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigen immer wieder: Die Preisspanne bei Wärmepumpenheizungen ist enorm.
Das liegt zwar teilweise an den Gebäuden: Eine Wärmepumpe im Neubau direkt mit zu planen ist eben günstiger, als einen unsanierten Altbau umzurüsten. Doch es gibt weitere Preistreiber: unerfahrene Handwerksbetriebe, unnötige Komponenten und überdimensionierte Geräte etwa.
Um zu verhindern, dass die Kosten für die neue Wärmepumpe aus dem Ruder laufen, sollten Hausbesitzer:innen von Anfang an kritisch und sorgfältig planen – und ganz genau hinsehen, was Energieberatung, Fachfirmen und Handwerker:innen empfehlen.
1. Mehrere Angebote einholen und prüfen
Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigte kürzlich: Die Angebote von Fachfirmen für den Einbau einer Wärmepumpe weichen drastisch voneinander ab. Nicht nur die Preisspanne ist groß – sie reicht von etwa 20.000 bis 63.000 Euro. Auch Qualität, Umfang und Verständlichkeit sind sehr unterschiedlich.
Ein vernünftiges Angebot sollte alle Kostenfaktoren transparent und detailliert aufschlüsseln. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, dass mindestens die folgenden Leistungen jeweils mit ihren Kosten separat ausgewiesen sein sollten:
- Wärmepumpe (reine Gerätekosten)
- Warmwasserbereitung
- Pufferspeicher
- hydraulischer Abgleich
- Fundament, Elektroinstallation
- Montage- bzw. Lohnkosten
- sonstiges Material
- Demontage/Entsorgung der Altanlage
Zu Vorsicht raten die Verbraucherschützer:innen, wenn Leistungen als „bauseits“ angegeben sind – das bedeutet, du musst dich selbst um die Leistung kümmern, möglicherweise andere Fachbetriebe beauftragen und bezahlen. Dabei können zusätzliche Kosten von rund 700 bis über 10.000 Euro entstehen.
„Bei der Elektroinstallation kann es richtig teuer werden,“ sagt Laura Vorbeck, Wärmepumpen-Expertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Mitautorin der Analyse. Deshalb sollte man besonders darauf achten, dass sie im Angebot enthalten ist.
👉 Hole unbedingt mehrere Angebote seriöser Fachunternehmen ein und vergleiche diese, bevor du dich für eines entscheidest.
Tipp: Beraten lassen
Eine unabhängige Energieberatung kann bei der Planung helfen, in dem sie etwa vorab bereits die notwendige Leistung für eine Wärmepumpe oder mögliche Sanierungsmaßnahmen identifiziert. Informiere dich am besten auch gleich zu deinen persönlichen Fördermöglichkeiten für die Wärmepumpe.
Wichtig: Qualifiziert für die staatlichen Förderprogramme sind nur Energieberater:innen auf der offiziellen Liste für Energieeffizienz-Experten.
👉 Um die Suche nach einem passenden Angebot abzukürzen, kannst du deine Adresse und Telefonnummer bei Portalen wie Enter hinterlassen. Die Plattformen vermitteln dir dann unverbindliche Angebote für zertifizierte Energieberater:innen.
👉 Wenn bereits ein Angebot vorliegt, gibt es Erklärungen und Rat bei den Verbraucherzentralen. Für den kostenlosen „Wärmepumpen-Angebots-Check“ kann man Angebote einschicken und von Expert:innen in einem Telefon- oder Videogespräch erläutern und bewerten lassen.
2. Den richtigen Fachbetrieb finden
Noch längst nicht alle Fachbetriebe haben viel Erfahrung mit Wärmepumpen. Darauf weisen Fachleute regelmäßig hin. Wenn ein unerfahrener Handwerksbetrieb zwei Wochen statt zwei Tage braucht, um die neue Heizung zu installieren, unnötig Komponenten austauscht oder das Gerät falsch dimensioniert, treibt das die Kosten in die Höhe.
Laut der Auswertung der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale sind die Unterschiede bei den Montage- bzw. Lohnkosten besonders groß. In der Analyse lagen sie zwischen knapp 2.500 und 12.500 Euro, der Median lag bei etwa 6.000 Euro. Energieexpertin Vorbeck weist darauf hin, dass die Lohn- und Montagekosten oft nicht einzeln ausgewiesen, sondern in anderen Angebotspositionen mit eingerechnet sind. „Das erschwert den direkten Vergleich von einzelnen Positionen in Angeboten und muss dabei berücksichtigt werden.“
Die Verbraucherschützerin rät, gezielt nach einem routinierten Installationsbetrieb zu suchen. „Man sollte darauf achten, dass der Heizungsbetrieb schon Erfahrungen beim Einbau von Wärmepumpen gesammelt hat.“ Frage am besten nach Referenzen und höre dich in der Nachbarschaft nach Erfahrungen mit den örtlichen Betrieben um. Ein lokaler Betrieb hat den Vorteil, dass mögliche Probleme persönlich gelöst werden können.
👉 Tipp: Es kann schwierig sein, Monteur:innen für eine Wärmepumpe im Umkreis zu finden. In diesen Fällen können Portale wie Aroundhome oder Heizungsfinder sinnvoll sein. Dort bekommst du unverbindliche Angebote von verschiedenen Installationsbetrieben in deiner Nähe.
3. Auf die richtige Dimensionierung der Wärmepumpe achten
Bei Wärmepumpen sind die korrekte Planung und Einstellung noch wichtiger als bei anderen Heizungstypen. Expert:innen raten dringend dazu, eine genaue raumweise Heizlastberechnung sowie einen hydraulischen Abgleich machen zu lassen. Das hilft, die korrekte Leistung für die geplante Wärmepumpe zu bestimmen und den Betrieb zu optimieren. Für Energieexpertin Vorbeck ist es deshalb ein Warnsignal, wenn ein Fachbetrieb im Angebot keinen hydraulischen Abgleich vorsieht. „Wenn der fehlt, mangelt es definitiv an Qualität.“ Der hydraulische Abgleich ist zudem eine Voraussetzung für staatliche Fördergelder.
Eine überdimensionierte Wärmepumpe ist nicht nur in der Anschaffung zu teuer – verschiedenen Schätzungen zufolge kostet sie 3.000 bis 10.000 Euro mehr. Sie braucht auch unnötig viel Strom und hat somit höhere Betriebskosten als ein korrekt ausgelegtes Gerät. Außerdem muss sie sich häufiger aus- und anschalten („takten“), was die Lebensdauer verkürzt.
👉 Fachleute empfehlen, die Wärmepumpe sehr genau passend zum tatsächlichen Bedarf planen zu lassen und lieber an den wenigen richtig kalten Tagen im Jahr einen zusätzlichen Heizstab zu nutzen als die Pumpe von vornherein zu groß zu dimensionieren.
Deshalb rät Vorbeck, bei der Planung der Wärmepumpe gleich zu berücksichtigen, ob energetische Sanierungsmaßnahmen geplant oder vorab sinnvoll sind. Durch zusätzliche Dämmung, neue Fenster oder ähnliche Schritte sinkt der Energiebedarf des Hauses und namit auch die nötige Leistung der Wärmepumpe.
4. Kosten für das Fundament senken
Damit die Außeneinheit einer typischen Luft-Wasser-Wärmepumpe sicher steht, vor Wasser und Frost geschützt ist und nicht zu stark vibriert, steht sie in der Regel auf einem Fundament. Allerdings kann man hier oft Kosten sparen. Die Preisspanne in den von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ausgewerteten Angeboten reichte von rund 250 bis zu fast 3.500 Euro. Durchschnittlich lagen die Kosten bei rund 1.500 Euro.
👉 Prüfe vorab, ob ein aufwändiges Fundament wirklich nötig ist. Einfachere Ausführungen können viel Geld sparen. Mit handwerklichem Geschick ist es sogar möglich, das Fundament selbst zu legen – allerdings solltest du das mit dem Installationsbetrieb vorab schriftlich vereinbaren.
5. Den alten Warmwasserspeicher behalten
Viele Installationsbetriebe bauen mit einer neuen Wärmepumpe auch standardmäßig einen neuen Warmwasserspeicher ein. Meist ist das sinnvoll – alleine schon aus Hygienegründen, wenn der vorhandene Speicher schon älter ist.
👉 Sollte dein Warmwasserspeicher aber noch nicht so alt sein und außerdem groß genug und mit der neuen Wärmepumpe kompatibel, kannst du leicht 2.000 Euro sparen.
Übrigens: Auch die Kosten für einen Pufferspeicher – der für Wärmepumpen als empfehlenswert gilt – können je nach Angebot stark variieren. Kläre hier unbedingt das notwendige Volumen ab, um überhöhte Kosten für einen überdimensionierten Speicher zu vermeiden.
6. Bei den Stromkosten sparen, auch ohne zweiten Stromzähler
Oft wird für eine Wärmepumpe standardmäßig ein zweiter Stromzähler eingebaut. Das ist nötig und kann sich lohnen, um spezielle, günstigere Wärmepumpen-Stromtarife zu nutzen. Damit kann man teils mehrere hundert Euro im Jahr an Stromkosten sparen. Wie teuer der Strom ist, hat damit auch einen großen Einfluss darauf, wie schnell sich die Wärmepumpe amortisiert. Deshalb kann sich auch die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe schnell lohnen.
Eine weitere Möglichkeit Stromkosten zu sparen: Paragraph 14 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) regelt, dass man Rabatte bei den Netzentgelten bekommt, wenn man den Netzbetreiber auf „steuerbare Verbauchseinrichtungen“ wie Wärmepumpen zugreifen und deren Leistung im Notfall drosseln lässt. Das gilt auch schon, wenn eine solche Steuerung in der Praxis noch gar nicht stattfindet. Geräte mit eher geringem Strombedarf können mit dem sogenannten Modul 1 (pauschaler Rabatt) auch ohne zweiten Zähler etwa 110 bis 210 Euro im Jahr sparen. Für größere Wärmepumpen kann sich Modul 2 (prozentualer Rabatt) lohnen – allerdings nur mit zweiten Zähler. Das kann im Einzelfall ebenfalls bis zu 400 Euro im Jahr ausmachen. Das sind mehrere tausend Euro über die Lebensspanne der Wärmepumpe.
Mehr dazu hier:
Wenn allerdings der Platz für einen zweiten Stromzähler fehlt und deshalb gleich ein kompletter neuer Sicherungskasten rein muss, solltest du gut durchrechnen, ob die mögliche Ersparnis durch den zweiten Zähler sich rechnet. Denn der Austausch des Schaltschranks kann im Extremfall mehrere tausend Euro kosten.
👉 Der Austausch eines einfachen analogen oder digitalen Stromzählers gegen ein Smart Meter kann sich in vielen Fällen lohnen: Damit kann man dynamische Stromtarife nutzen, welche im besten Fall noch einmal ein paar hundert Euro im Jahr sparen. Der freiwillige Einbau sollte nicht mehr als 100 Euro kosten.
7. Förderung sichern
Für den Einbau von Wärmepumpen gibt es hohe Förderungen: zwischen 30 und 70 Prozent der Kosten übernimmt der Staat. Die Grundförderung beträgt 30 Prozent. Zwei Dinge lohnen sich zusätzlich besonders: Den sogenannten „Speed-Bonus“ in Höhe von 20 Prozent bekommen nur Haushalte, die vor Ende 2028 von einer alten fossilen Heizung auf eine klimafreundliche Heizung umsteigen.
Es macht außerdem einen Unterschied, welches Kältemittel in der gewählten Wärmepumpe zirkuliert. Für umweltfreundliche Kältemittel wie zum Beispiel Propan gibt es einen weiteren Bonus in Höhe von 5 Prozent. Den gibt es auch für Wärmepumpen, die Wasser, Abwasser oder Erdreich als Wärmequelle nutzen.
👉 Bei 70 Prozent Förderung landen nur Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 40.000 Euro im Jahr. Doch wer darüber liegt, kann mit schlauer Planung immer noch 55 Prozent der Kosten erstattet bekommen.
Tipp: Stelle sicher, dass dein gewähltes Modell auf der Liste der förderfähigen Wärmepumpen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) steht. Auf die meisten handelsüblichen Modelle trifft das zu.
8. Betrieb von Anfang an optimieren
Je effizienter eine Wärmepumpe läuft, desto weniger Strom braucht sie und desto günstiger ist der Betrieb. Der größte Hebel ist hier die Vorlauftemperatur, die für Wärmepumpen niedriger liegen sollte als für Gasheizungen. „Jedes Grad niedriger erhöht die Effizienz um zwei bis drei Prozent. Hier steckt großes Einsparpotential drin“, erklärt Vorbeck.
👉 Oft kann der Autausch einzelner Heizkörper die nötige Vorlauftemperatur und damit auch die Betriebskosten deutlich senken. „Beim Austausch der Heizkörper sollte man nicht sparen“, empfiehlt die Expertin.
Ein weiterer Kostenfaktor im Betrieb: Bei neuen Wärmepumpen ist mitunter die Heizkurve ab Werk zu hoch eingestellt. Eine umfassende Untersuchung von Forschenden der ETH Zürich zeigte: Viele Wärmepumpen laufen im Betrieb weniger effizient als sie könnten. Bei knapp 40 Prozent der untersuchten Geräte war die Heizkurve zu hoch eingestellt. Das zwingt die Wärmepumpe, unnötig hohe Vorlauftemperaturen zu erzeugen, was ihre Effizienz senkt und die Stromkosten erhöht.
👉 Wenn du es dir nicht selbst zutraust, bitte den zuständigen Fachbetrieb, die Heizkurve zu prüfen und falls möglich zu senken.
Auch die Nachtabsenkung kann im Betrieb unnötig Geld kosten. Aus der Zeit der fossilen Heizungen sind viele Menschen daran gewöhnt, die Heiztemperatur am Abend abzusenken und am Morgen wieder zu erhöhen, um in der Nacht Brennstoff zu sparen.
👉 Bei Wärmepumpen ist in der Regel der durchgehende Betrieb effizienter, weil das Aufheizen am Morgen sonst viel Energie braucht. Das gilt insbesondere in Kombination mit Fußbodenheizungen und in gut gedämmten Gebäuden.