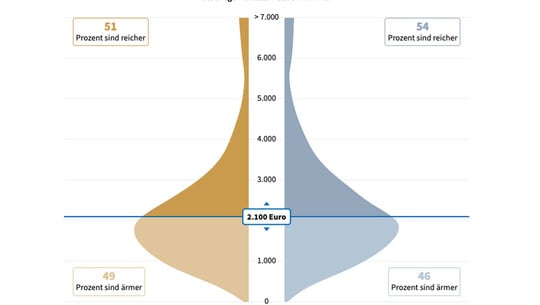Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Das muss sie auch, denn ohne sie wird es vor dem Hintergrund des Klimawandels keine Zukunft geben. Doch die aktuelle gesellschaftliche Diskussion darüber zeigt, dass wir dem Begriff neues Leben einhauchen müssen. Es ist höchste Zeit für ein Reframing von Nachhaltigkeit.
Ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft, ohne Zukunft keine Nachhaltigkeit. So einfach ist das erst einmal. Doch in der Praxis zeigt sich momentan, dass es alles andere als einfach ist und lange nicht jeder diese Gleichung verinnerlicht hat. Seit nunmehr einem halben Jahr geht die “Fridays for Future”-Bewegung – und mit ihr zehntausende junge Menschen – auf Deutschlands Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In ihrem Rücken bilden sich mittlerweile Bündnisse von Wissenschaftler*innen, Unternehmer*innen und Eltern, welche einmal mehr die Dringlichkeit des Themas unterstreichen. Die Reaktion der Politik? Verweist auf „Profis”, denen man das überlassen solle, und auf die Vernachlässigung der Schulpflicht.
Und gibt es dann doch mal Politiker*innen, die eine progressive, zukunftsfähige Idee äußern (zum Beispiel weniger Autos in Innenstädten, Tempolimits auf Autobahnen, höhere Preise für Flüge oder gar eine CO2-Steuer), wird direkt von der anderen Seite die Verbotskeule ausgepackt und jede Diskussion erhärtet sich im Keim. „Ich lasse mir doch nicht mein Auto und erst recht nicht mein Schnitzel verbieten!“ schreit man da lauthals hinaus. Ist das eine gute Ausgangslage für echten Wandel? Auf keinen Fall. Gesellschaftlicher Fortschritt? Fehlanzeige. Chancen auf eine Zukunft ohne katastrophale Klimawandelfolgen? Stand jetzt tendiert gegen Null.

Irgendwie treten wir auf der Stelle. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit neuer Produktions- und Konsummuster so gar nicht neu. Bereits 1972 war es der Club of Rome, der mit einer vielbeachteten Publikation an die (planetaren) Grenzen des Wachstums erinnerte. Um irreparable Schäden an der Umwelt und damit enorme Risiken für die Weltbevölkerung zu verhindern, brauche es einen „ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand.“ 30 Millionen Exemplare dieser Publikation in etwa 30 Sprachen später fragt man sich, was sich seit jeher wirklich getan hat.
„Nachhaltigkeit ist wie Teenager-Sex: Alle reden unentwegt davon. Gemacht wird es eher selten. Und wenn es gemacht wird, ist es nicht gerade toll.“, fasste der GreenBiz-Gründer Joel Markower mal seine Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit zusammen. Und man könnte ihm nicht mehr zustimmen. Denn es ist zweifelsohne so, dass Nachhaltigkeit in vielen Bereichen immer noch mit etwas Negativem, zu oft und dabei ausschließlich mit Einschränkung und/oder gar Verzicht verbunden wird. Unternehmen sehen darin nur kurzfristige Mehrausgaben, Politiker eine Schar potentiell vergraulter Industriewähler*innen und die Bevölkerung ein Leben wie im Mittelalter.
Halt, Stop! Bevor wir uns jetzt wieder in irgendwelchen Verbotsdiskussionen Satz für Satz unkonstruktive Aussagen an den Kopf werfen, sollten wir versuchen eine Sache zu verstehen: Nachhaltigkeit will keine Optionen limitieren, sondern Möglichkeitsräume schaffen. Im Zentrum: Ein Leben in Zukunft. Und gesellschaftlicher Wandel entsteht nicht durch Schuld, sondern Wandel entsteht prinzipiell durch Möglichkeiten. Und wir haben in Sachen Nachhaltigkeit nur einen Bruchteil denkbarer Möglichkeiten ernsthaft ausgeschöpft.
Im Hinblick auf mögliche Zukunftsstrategien bedeutet dies vor allem eins: Weg vom Effizienzdenken, hin zur Konsistenz und vor allem auch zur Suffizienz. Denn wie sagte der Cradle-to-Cradle-Pionier Prof. Braungart bereits: „Wenn ein System zerstörerisch ist, sollte man nicht den Versuch machen, es effizienter zu gestalten. Stattdessen sollte man Möglichkeiten finden, es vollständig umzukrempeln.“ Soll heißen: Wenn etwas weniger schlecht ist, ist es noch lange nicht gut.

Rebound-Effekt macht Effizienzgewinne zunichte
So wurden unsere Autos über die Jahre in ihrem Verbrauch zwar sparsamer, aber im gleichen Atemzug größer und wir haben sie häufiger genutzt. Auch unsere strombetriebenen Haushaltsgeräte sind in den vergangenen 30 Jahren zwar um 37 Prozent energieeffizienter geworden – doch gleichzeitig stieg auch der Stromverbrauch um 22 Prozent. Was in der Wissenschaft „Rebound-Effekt“ genannt wird, meint letztlich einfach nur, dass wir trotz Effizienzgewinnen in vielen Bereichen nicht zwingend weniger Ressourcen verbrauchen und dementsprechend nicht nachhaltiger leben als zuvor.
Angesichts der Tatsache, dass in vielen Bereichen die ökologischen Grenzen der planetaren Tragfähigkeit bereits erreicht sind, wird immer häufiger die Ökoeffektivität als Gegenmodell zur Ökoeffizienz diskutiert: Durch radikale Innovationen sollen bestehende Produkte und Technologien substituiert oder umweltverträglicher gemacht werden. Wenn die Firma adidas Sportschuhe aus eingesammeltem “Ozeanplastik” herstellt, geht das zwar in eben jene Richtung, wirkt aber im Vergleich zur Herstellung eines nach Fleisch aussehenden, schmeckenden und blutenden Burgerpatties aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen eher wie ein auf Symptome reduzierter Werbegag.
Und natürlich wäre auch die E-Mobilität als Paradebeispiel für eine ökoeffektive Innovation zu nennen, doch nur so lange der sie antreibende Strom auch aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird. Außerdem bräuchten wir dann auch noch eine kreislauftaugliche Lösung für die Batterien, um nicht auch hier – früher oder später – aufgrund des Rebound-Effekts an die planetaren Grenzen zu gelangen.

Nachhaltigkeit als Kulturfrage
Für Unternehmen und Politik bedeutet der Rebound-Effekt vor allem, dass man sich in Zukunft nicht allein auf technische Lösungen verlassen sollte. Eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft erfordert deshalb (zumindest auch) Strategien, die eine absolute Reduktion unseres Energie- und Ressourcenverbrauchs herbeiführen. Es ist also vor allem auch eine Kulturfrage. Echte Nachhaltigkeit lässt sich erst erreichen, wenn naturverträgliche, technische Innovationen auf veränderte Produktions- und Konsummuster treffen.
Hier offenbart sich viel Potenzial für die Pioniere zukunftsfähiger Wirtschaftsparadigmen, die Wachstum nicht quantitativ, sondern qualitativ verstehen – und damit auch innerhalb eines endlichen terrestrischen Systems erfolgreich wirtschaften. Man könnte sagen: Wir brauchen mehr Akteure einer Ermächtigungs- und Ermöglichungswirtschaft. Die Politik muss bei dieser Transformation helfen, indem sie entsprechende (ordoliberale) Rahmenbedingungen setzt.
Ein Beispiel aus der Praxis: Es kann nicht sein, dass es für Unternehmen der Lebensmittelindustrie heutzutage immer noch günstiger ist, perfekt genießbare Ware einfach wegzuwerfen und zu vernichten, anstatt sie weiterzuverteilen – sei es an karitative Einrichtungen, die Tierfütterung, oder Start-ups die diese upcyceln. Ob wir dann nun ein Zuckerbrot- oder Peitsche-Modell implementieren und Unternehmen Steueranreize oder Geldstrafen in Aussicht stellen, kann man dann immer noch diskutieren. Klar ist aber, dass wir das System in dieser Hinsicht anpassen müssen.
Denn man mag sich vielleicht wenig darunter vorstellen können, wieviel 1,3 Milliarden Tonnen jährlich weltweit verschwendeter Lebensmittel am Ende sind. Doch wenn man sich vor Augen führt, dass wir damit künstlich und gänzlich unnötig den drittgrößten CO2-Emittenten nach China und den USA heraufbeschwören (und damit umsonst den Klimawandel anheizen), sollte einen das doch eigentlich prinzipiell schnell handeln lassen.
Wo wir in diesem Kontext aber auf keinen Fall drumherum kommen: Die Wachstumsfrage. Jahrzehntelang wurde wirtschaftliches, also rein quantitatives Wachstum mit Wohlstand gleichgesetzt. Nun sind wir unlängst an einem Punkt gekommen, an welchem wir das “immer höher, immer weiter, immer schneller” grundlegend in Frage stellen.
Doch keine Sorge: Das Ende des herkömmlichen Wachstums muss nicht das Ende des Wachstums generell bedeuten. Bereits Smith, Marx und Mill gingen davon aus, dass Wirtschaft auf einen stationären Zustand hinsteuere. Doch genau dann beginne das echte Wachstum – nicht materiell, sondern geistig-kulturell –, das Wachstum der Sinnökonomie! Aus strategischer Sicht folgt daraus das Auflösen von Wachstumszwängen. Damit ist keine Absage an unternehmerisches Wachstum gemeint, sondern die Wiederherstellung unternehmerischer Entscheidungsfreiheit – zu wachsen, zu schrumpfen, sich zu wandeln, sich neu zu erfinden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich auch die großen Trends der Slowness (d.h. der Entschleunigung) sowie der Mindfulness (d.h. der Achtsamkeit) erklären, die sowohl im unternehmerischen, aber deshalb eben auch schon längst im gesellschaftlichen Kontext immer deutlicher spürbar sind. Wo die Welt aufgrund des blinden Wachstumsdrangs immer komplexer und unübersichtlicher zu werden scheint (und wir dadurch immer mehr überfordert sind), sehnen wir uns Menschen nach Natürlichkeit, Authentizität und Einfachheit. Doch hier geht es eben nicht um ein Zurück, sondern um ein nach Vorne in die Zukunft.
Wir wollen raus aus dem Hamsterrad des „immer höher, immer weiter, immer mehr.“ Beispielsweise Slow Food oder Minimalismus sind nicht zuletzt deshalb so populär geworden, da sie – aufgrund gesteigerter Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der Welt und den Mitmenschen – wieder mehr Resonanz ermöglichen und dadurch das individuelle Wohlbefinden steigern.
Optimismus statt Katastrophismus
Womit wir wieder beim Knackpunkt wären: Ein Mehr an Nachhaltigkeit bedeutet immer auch ein Mehr an Gesundheit, Lebensqualität und damit Zukunftsfitness. Beim Zukunftsinstitut in Frankfurt sprechen wir in einer Studie in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. André Reichel von „Next Growth“ – einer neuen Vision des Wachstums und Zusammenlebens. Das Wuppertal Institut um Prof. Schneidewind nennt es „Zukunftskunst“ und zielt damit vor allem auf eine Kultur des Wandels ab. Beide Ansätze meinen im Kern das gleiche: Eine Transformation unseres gegenwärtigen Systems – und damit die Art und Weise wie wir Politik machen, wirtschaften, konsumieren und generell leben. Ein wichtiges Element hierbei: Der konstruktive, optimistische Unterton.

Denn vielleicht ist auch unsere Sprache daran Schuld, dass wir ökologisch denkende Mitmenschen seit Jahrzehnten unsere eigenen Süppchen kochen und es nicht schaffen, mit unseren Visionen für eine bessere Welt so richtig in die gesellschaftliche Mitte vorzudringen. Die Kommunikation über bevorstehende Katastrophen und Appelle an Furcht und Angst steigern zwar die Aufmerksamkeit, lösen aber auch Abwehrverhalten und Vermeidungsreaktionen aus. Katastrophismus bringt die Leute nicht ins Handeln, sondern lähmt sie und lässt sie zunächst erstmal abwehrend reagieren. „Und wenn die Welt eh untergeht, kann ich ja auch nochmal mit meinem SUV und 200 Sachen über die Autobahn brettern, ehe ich meine 2 Euro-Discounter-Nackensteaks auf meinem brandneuen Webergrill ein zweites Mal töte.“
Nachhaltigkeit braucht einen Tapetenwechsel. Wir müssen es schaffen, persönliche Relevanz zu erzeugen – und zwar für alle im Hier und Jetzt. Wir müssen es schaffen, dass nachhaltiges Verhalten nicht nur einfacher wird, sondern auch günstiger und erstrebenswerter. Es sollte deshalb nicht um Autoverbote gehen, sondern wie wir unsere Städte fahrradfreundlicher und damit allgemein lebenswerter gestalten können. Es sollte nicht um Fleischverbote gehen, sondern um echte Preise für Fleisch (d.h. inkl. externer Folgekosten!) und genussvolle Alternativen „beyond“ fader Veggie-Schnitzel. Es sollte nicht um Minimalismus und den Zwang des Verzichts gehen, sondern einen Maximalismus und damit die Freiheit, seinen Konsum auf ein wohltuendes und erlebnisorientiertes Maß zu reduzieren.
Wie ich oben bereits ausführte: Wandel entsteht durch Möglichkeiten. Und er wird generell angetrieben durch Visionen und Dringlichkeit – beides Dinge, welche wir in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation spüren können. Nun sind wir alle in der Verantwortung. Ganz praktisch heißt das damit auch: Schnitzel- oder Flugscham (vom schwedischen Pendant “flygskam”) sind zwar gerade viel und vor allem heiß diskutiert, ändern aber nicht zwingend etwas am zugrunde liegenden System. Solange Fleisch und Fliegen nicht im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung bepreist, viel schlimmer noch subventioniert werden, so lange bleiben die Anreize für einen entsprechenden Konsum zu hoch.

Was wir nun tun müssen:
- Die Politik muss nachhaltiges Leben einfacher und günstiger machen;
- die Wissenschaft muss als “Möglichkeitswissenschaft” fortlaufend nachhaltigere Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle entwerfen;
- die Zivilgesellschaft muss mit ihren Pionieren diese Utopien in Reallaboren vorleben und
- die Unternehmen müssen diese dann in die Mitte der Gesellschaft tragen.
Noch ist es durchaus möglich, dass wir diese Transformation „by design“ hinbekommen und damit demokratisch, sozialverträglich sowie unter Berücksichtigung vieler bis aller Bedürfnisse. Und damit eben nicht „by desaster“, also ungeplant und durch Katastrophen verursacht. Dies erfordert ein Mindset des Possibilismus, der das Mögliche unserer Welt in Anbetracht der großen Herausforderungen um Klimawandel & Co. betont. Im Unterschied zu extremen Optimismus unterscheidet er sich dadurch, dass das Böse und Schlechte weder ausgeklammert, noch ignoriert wird. Positiver Wandel ist möglich, gerade aufgrund derartiger Probleme.
Der Beitrag erschien ursprünglich im Triodos-Bank-Blog diefarbedesgeldes.de
Jetzt zu einem nachhaltigen Girokonto bei der Triodos Bank wechseln!
Noch mehr spannende Artikel zum Thema findest du:
- auf dem Blog Die Farbe des Geldes
- Tschüss Wirtschaftswachstum – ein Appell für ein neues Wirtschaftsbild
- Jetzt einfach wechseln: Mit diesen fünf Banken machst du alles richtig
- Die besten nachhaltigen Robo-Advisors im Vergleich
- Besser als Tages- und Festgeld? Wann sich Geldmarktfonds lohnen und wie nachhaltig sie sind
- Die besten nachhaltigen Girokonten für Kinder und Jugendliche
- "Das dürfen wir uns von den Männern abgucken" – Finanzexpertin über Gehaltsverhandlungen
- Wie eine Berliner Hausgemeinschaft Immobilieninvestoren ein Schnippchen schlug
-
Minimalismus:
weniger Haben = mehr Sein - Nachhaltige Depots: Banken und Neobroker im Vergleich
- E-Lastenrad-Förderung: Diese Möglichkeiten hast du
- Die besten Stellenportale für grüne, faire & sinnvolle Jobs