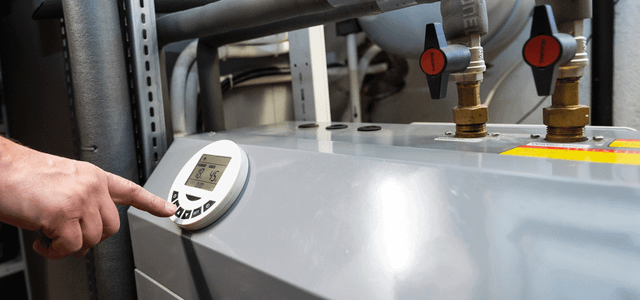Wärmepumpen gelten als wichtigstes Heizsystem, um klimaschonend zu heizen und unabhängiger von Gas und Öl zu werden. Sie funktionieren in vielen Gebäuden, für den Einbau gibt es hohe Förderungen. Doch einige Fehler können den Betrieb der Wärmepumpe teuer und ineffizient machen.
Orange unterstrichene oder mit ** markierte Links sind Partnerlinks. Wenn du darüber bestellst, erhalten wir einen kleinen Anteil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.
Gegenüber den noch immer verbreitten Gas- und Ölheizungen haben Wärmepumpen entscheidende Vorteile: Sie sind sehr effizient und sie brauchen keine fossilen Brennstoffe. Den nötigen Strom können viele Haushalte mittels Photovoltaik selbst erzeugen – oder aber zumindest aus erneuerbaren Quellen beziehen. Damit ist der Betrieb der Wärmepumpe quasi klimaneutral.
Entgegen gängiger Vorurteile eignen sich moderne Wärmepumpen auch für viele Altbauten und eine Fußbodenheizung ist nicht unbedingt nötig. Trotzdem passt das Heizsystem nicht zu jedem Haus. Wo sich eine Wärmepumpe eignet, sollte man bei der Planung und Installation sorgfältig vorgehen: Fehler können dafür sorgen, dass die Heizung ineffizient und damit teuer ist – und der Klimavorteil verpufft.
👉 Wir zeigen, welche Fehler man bei der Anschaffung einer Wärmepumpe vermeiden sollte:
- Zu wenig Beratung
- Das vorhandene Heizsystem nicht ausreichend berücksichtigen
- Falsche Dimensionierung der Wärmepumpe
- Falsche Reihefolge bei der Sanierung
- Falscher Aufstellort
- Klimaschädliche Kältemittel nutzen
- Wärmepumpe mit Graustrom betreiben
1. Wärmepumpen-Fehler: Zu wenig Beratung
Vor der Anschaffung einer Wärmepumpe – egal ob im Neubau oder im Altbau – sollte man gründlich bewerten, unter welchen Voraussetzungen diese Heizart für die konkreten Gegebenheiten Sinn macht. Dafür sollte man sich Hilfe bei Fachleuten wie Energieberater:innen und qualifizierten (!) Handwerksbetrieben holen. Wenn sich der Einbau einer Wärmepumpe lohnen soll, muss vorher feststehen, dass die Heizung auch wirklich effizient funktionieren kann.
👉 Wir empfehlen, eine professionelle Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Aktuell wird die Energieberatung mit 50% der Kosten gefördert, wenn sie jemand durchgeführt, der in der „Energieffizienz-Expertenliste“ der DENA gelistet ist. Mehr Infos dazu gibt es beim BAFA. Bei der Wahl des oder der Expert:in solltest du darauf achten, das diese erwiesene Erfahrungen mit Wärmepumpen mitbringt und im Zweifelsfall nach Referenzen fragen.
Auch wichtig: Für den Einbau einen Handwerksbetrieb finden, der sich wirklich mit Wärmepumpen auskennt und das Gerät optimal einstellen kann. Nicht alle Fachkräfte verfügen schon über die nötigen Qualifikationen und Erfahrungen. Auch hier lohnt es sich, genau nachzufragen.
👉 Wenn du Schwierigkeiten hast, Monteur:innen für eine Wärmepumpe im Umkreis zu finden, können Portale wie Aroundhome oder Heizungsfinder sinnvoll sein. Dort bekommst du unverbindliche Angebote von verschiedenen Installationsbetrieben in deiner Nähe.
2. Wärmepumpen-Fehler: Mit dem falschen Heizsystem planen
Damit Wärmepumpen effizient arbeiten können, müssen einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein: Das im Haus verbaute Heizsystem sollte mit einer relativ niedrigen Vorlauftemperatur funktionieren. Diese sollte bei maximal 50 bis 60 Grad Celsius im Dauerbetrieb liegen – ideal für Wärmepumpen sind Werte von 30 bis 40 Grad Celsius.
Für die Effizienz am besten sind Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen. Dennoch kommen moderne Wärmepumpen inzwischen mit verschiedensten Arten von Heizkörpern aus. Wichtig ist, dass diese nicht zu klein sind. Um altmodische Rippenheizkörper richtig aufzuheizen, reichen die mittels Wärmepumpe erzeugten Temperaturen oft nicht aus. Zumindest solche alten Heizkörper gegen so genannte Flach- oder Plattenheizkörper auszutauschen kann sich vor der Anschaffung einer Wärmepumpe lohnen. Wenn es lediglich um den Autausch einzelner Heizkörper geht – wie ihn viele Fachleute empfehlen – sind auch die Kosten überschaubar.
👉 Tipp: Ein relativ einfacher Test kann helfen zu entscheiden, ob sich eine Wärmepumpe für dein Haus eignet: Die Vorlauftemperatur an einem kalten Tag auf etwa 50 Grad Celsius einstellen und beobachten, ob alle Heizkörper und Räume ausreichend warm werden.
3. Wärmepumpen-Fehler: Falsche Dimensionierung der Pumpe
Damit die Wärmepumpe den optimalen Nutzen bringt und keine Fehlinvestition wird, muss man auf die richtige Dimensionierung der Pumpe achten. Wärmepumpen sind darauf ausgerichtet, langfristig Heizwärme zu erzeugen. Hierfür muss die Leistung der Heizung zum Gebäude passen und es sollte von vornherein bekannt sein, wie viel Energie (in Kilowatt pro Quadratmeter) in etwa benötigt wird.
Eine falsch dimensionierte Wärmepumpe kann zu teuren Problemen führen: Ist die Anlage zu klein, kann sie den Wärmebedarf des Hauses nicht decken – es wird nicht richtig warm wird oder man braucht zusätzliche Heizquellen. Eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe arbeitet ineffizient und verbraucht unnötig viel Strom. Lass dich hier unbedingt professionell beraten.
Worauf musst du bei der Dimensionierung achten?
- Eine professionelle Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und die gewünschte Raumtemperatur.
- Fachleute halten in Bestandsbauten einen hydraulischen Abgleich für unerlässlich. Wenn staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden, ist er Pflicht. Er hilft, die Heizwärme gleichmäßig im System zu verteilen, so dass alle Heizkörper gleich warm werden.
- Wird die Wärme mittels Fußbodenheizung oder Heizkörpern verteilt? Flächenheizungen brauchen meist weniger Heizleistung.
- Den Warmwasserbedarf richtig berechnen: In den meisten Fällen erwärmt die Wärmepumpe auch das Warmwasser. Der Bedarf hängt von persönlichen Gewohnheiten und der Anzahl der Personen im Haushalt ab.
- Plane auch mögliche Veränderungen in der Zukunft mit ein, zum Beispiel eine Sanierung, einen Anbau oder Familienzuwachs.

Die Heizleistung wird in kW angegeben. In Abhängigkeit von der Gebäudeart, Dämmung, Umgebung und individuellen Wünschen benötigt eine Wärmepumpe grob zwischen 0,015 (Passivhaus) und 0,1 kW (unsanierter Altbau) pro Quadratmeter. Ein gut gedämmter Neubau kann so zum Beispiel auf eine Heizlast von rund 4 kW kommen, für einen Altbau können es um die 20 kW sein.
👉 Tipp: Der Bundesverband Wärmepumpe bietet einen hilfreichen Heizlastrechner an, der Orientierung bieten kann, welche Heizleistung eine Wärmepumpe erbringen muss. Dennoch: Um die passende Dimensionierung für die Wärmepumpe zu ermitteln, empfiehlt es sich dringend, einen Fachbetrieb hinzuzuziehen.
Mehr lesen: JAZ: Das bedeutet die Jahresarbeitszahl bei Wärmepumpen
4. Wärmepumpen-Fehler: Falsche Reihenfolge bei der Sanierung
Je stärker ein Haus beheizt werden muss, desto mehr Strom ist für die Wärmepumpe notwendig und desto höher werden die Betriebskosten. Wärmepumpen laufen also in einigermaßen gut gedämmten Häusern am effizientesten, d.h. in zumindest teilweise sanierten oder relativ neu gebauten Häusern.
Es ist zwar in den meisten Fällen möglich, eine Wärmepumpe im Altbau nachzurüsten. Studien zeigen immer wieder, dass sie sich für mehr Gebäude (und mit weniger Aufwand) eignen, als angenommen. Aber in unsanierten oder schlecht gedämmten Häusern muss man besonders gut planen, unter welchen Voraussetzungen sich der Einbau einer Wärmepumpe lohnt. Reicht etwa der Austausch von alten Heizkörpern, würden neue Fenster den Wärmeverlust verringern oder braucht es mehr Dämmung?
👉 Im Altbau sollte man sich unbedingt beraten lassen, ob und in welchem Umfang eine energetische Sanierung einem Heizungstausch vorausgehen sollte.
Diese ist aus Klimaschutzgründen in vielen Fällen sowieso sinnvoll. Weil finanziell oft kaum alles auf einmal zu stemmen ist, kann es ratsam sein, sich zuerst um Dämmung, neue Fenster usw. zu kümmern und später um den Heizungstausch. Denn: Eine Sanierung kann dazu führen, dass man mit einer kleiner dimensionierten und damit günstigeren Wärmepumpe planen kann. Eine Einschätzung und Beratung durch Fachleute ist hier wichtig.
5. Wärmepumpen-Fehler: Der falsche Aufstellort
In vielen Innenstadt- und Mehrfamilienhäusern ist der Einbau einer Wärmepumpe nicht ganz einfach. Denn neben dem bisherigen Heizsystem spielt auch die Lage des Gebäudes und der verfügbare Platz eine Rolle. Die Außeneinheit von Luft-Wärmepumpen, die typischerweise neben dem Haus steht, braucht ausreichend Platz und eine ebene Standfläche.
Auch wenn der Platz reicht, sollte man den Aufstellort klug wählen: Starker Wind, der direkt auf die Wärmepumpe trifft, kann den Heiz- und Abtaubetrieb beeinträchtigen. Wähle daher am besten einen windgeschützten Platz.
Auch wichtig: Die Lautstärke der Wärmepumpe beachten. Luft-Wärmepumpen verursachen Geräusche, etwas Abstand zu den Nachbar:innen und Bewohner:innen ist also ratsam und teils sogar vorgeschrieben. Moderne Wärmepumpen werden zwar immer leiser, doch die Schallschutzregeln gilt es zu beachten. Fachleuten zufolge erfüllt man diese mit modernen Geräten meist mit etwa drei Metern Abstand zur benachbarten Hauswand. Expert:innen halten sie damit übrigens auch für Reihenhäuser für sinnvoll.
Wer über den Einbau einer Grundwasser- oder Erdwärmepumpe nachdenkt – also eine Wärmepumpe, welche die Temperatur im Grundwasser oder Erdreich nutzt, um sie in Heizwärme umzuwandeln – braucht ausreichend Platz für die notwendigen Bohrungen. Diese Voraussetzungen können viele Gebäude in Innenstadtlage nur schwer erfüllen. Hier kann der Anschluss an ein Fernwärme-Netz die einfachere Lösung sein.
6. Wärmepumpen-Fehler: Klimaschädliche Kältemittel in der Wärmepumpe
Wärmepumpen brauchen Kältemittel. Sie nutzen Außenwärme und wandeln diese in Wärme für Innenräume um. Das Kältemittel ist, vereinfach gesagt, dafür zuständig, diese Außenwärme aufzunehmen, weiter zu erhitzen und nach innen wieder abzugeben. Auch bei niedrigen Außentemperaturen verdampft das Kältemittel und entzieht der Außenluft Wärme. Anschließend wird das so entstandene Gas in der Wärmepumpe wieder verdichtet und das Temperaturniveau auf die gewünschte Raumtemperatur gebracht. Dadurch kondensiert das gasförmige Kältemittel und gibt dabei Wärme an den Heizkreislauf ab.

Dabei sind ebendiese Kältemittel nicht unkritisch und in der Vergangenheit wurden auch FCKWs eingesetzt, die inzwischen wegen ihrer schädlichen Wirkung auf die Ozonschicht verboten sind. Auch heute noch gängige Kältemittel haben ein erhebliches Treibhauspotential. Zwar gilt dies nur für den Fall, dass es der Wärmepumpe entweicht, doch ist die Nutzung von beispielsweise R410A ab 2025 in Split-Wärmepumpen verboten.
Als Alternative gilt unter anderem das Kältemittel R32, welches immer noch ein hohes Treibhauspotenzial hat (nämlich die 675-fache Treibhauswirkung von CO2), jedoch weitaus geringer als der Vorläufer. Stiebel Eltron etwa nutzt R454C (148-fache Treibhauswirkung von CO2). Alternativ setzen immer mehr Hersteller Propan (R290) als Kältemittel ein (3-fache Treibhauswirkung von CO2). Auch hier gilt, sich vor dem Kauf einer Wärmepumpe fachgerecht beraten zu lassen und nachzufragen.
👉 Tipp: Für Heizsysteme mit natürlichen Kältemitteln gibt es bei der Förderung einen Extra-Bonus in Höhe von 5 %.
7. Wärmepumpen-Fehler: Keinen Ökostrom beziehen
Für den Betrieb brauchen Wärmepumpen Strom. Im Gesamt-Strommix stammen in Deutschland immer noch knapp 40 Prozent aus konventionellen Energieträgern, davon rund 20 Prozent des Stroms aus Kohleverbrennung (Stand: September 2024). Auch wenn natürlich der Anteil fossiler Energien deutlich geringer ist als bei Gas- oder Ölheizungen, ist der Strom eben derzeit noch nicht klimaneutral.
👉 Den größten Vorteil fürs Klima hat eine Wärmepumpe, wenn sie (rechnerisch) mit reinem Ökostrom betrieben wird. Im Idealfall bezieht man zumindest einen Teil des Stroms aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage. Diese Kombination ist übrigens auch langfristig am kostengünstigsten. Der Strom aus dem Netz sollte unbedingt von einem seriösen Ökostrom-Anbieter stammen.
Kennst du schon den Utopia-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts & Co?
** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.- Spiele mit Mission: 8 gelungene Games zu Umwelt & Klima
- Was sind umweltneutrale Produkte – und wie funktioniert die Herstellung?
- Sonderbericht des Weltklimarats: Eine Katastrophe im Jahr
- Geld sparen: Ist es günstiger, wenn man die Waschmaschine nachts laufen lässt?
- CO2-Kompensation in der Kritik: Solltest du deine nächste Reise ausgleichen?
- Unterwäsche waschen: Warum 60 Grad gar nicht nötig sind
- CO2-Rechner: 6 Webseiten, mit denen du deine Klimabilanz errechnen kannst
- Digitalfußabdruck reduzieren: 10 Klimaschutz-Tipps gegen Digital Waste
- Umweltneutrale Geschäfte: Das Einkaufen nachhaltiger gestalten