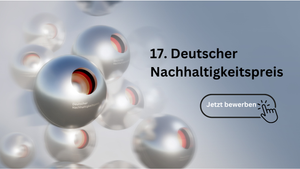Ivonne Fernández ist Autistin mit ADHS. Viel wird über neurodivergente Menschen gesprochen – eher selten mit ihnen. Im Utopia-Interview gibt die 40-jährige Psychologin Einblicke in ihr Leben; erklärt, was die Diagnose für sie bedeutet – und was sie sich von der neurotypischen Gesellschaft wünscht.
In öffentlichen Debatten über Autismus und ADHS – sofern sie geführt werden – kommen oft Mediziner:innen zu Wort. Sogenannte Expert:innen, die jene von der ICD klassifizierten „Störungen“ für Leser:innen und Interessierte einordnen. In Deutschland wie in anderen Ländern bildet die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) die Grundlage für Diagnosen durch Fachpersonal.
Wie aber lebt es sich als autistischer Mensch mit ADHS? Diese Frage können neurotypische Expert:innen – also Menschen, deren Gehirne normgemäß funktionieren – wohl kaum authentisch beantworten. Die Neurodiversitäts-Bewegung setzt sich daher für einen besseren Umgang mit neurodivergenten Menschen ein. Ivonne Fernández ist eine von ihnen.
Die 40-jährige Psychologin ist Autistin mit ADHS. 2019 gründete sie den gemeinnützigen Verein Neurodivers e.V., um neurodivergente Erwachsene und Kinder miteinander zu vernetzen und sich für ihre Belange einzusetzen. Im Utopia-Interview stellt Fernández klar: Die sogenannten Störungen seien ein natürlicher Teil der menschlichen Vielfalt. Ein Gespräch über Fernández‘ persönliche Erfahrungen, „bizarre“ Verhaltensweisen neurotypischer Menschen – und politisch korrekte Sprache, die diskriminierend sein kann.
Autistische Frauen werden oft missverstanden
Utopia: Wie fühlt es sich an, als Autistin und mit ADHS diagnostiziert zu werden?
Fernández: Erleichternd, weil es ein langer Weg ist, die Diagnose überhaupt zu bekommen. Außerdem ist die Versorgungssituation in Deutschland katastrophal. Die wenigen Diagnostikstellen, die es gibt, sind oft nicht auf dem neuesten Stand und können zum Beispiel kaum Frauen diagnostizieren, weil sie von einem männlichen Standard ausgehen, der noch aus den 80ern ist.
Utopia: Solche Fälle sind in der Medizin keine Seltenheit. Etwa wurden klinische Studien jahrzehntelang nur mit Männern durchgeführt und man nahm einfach an, dass der weibliche Körper genauso auf die getesteten Medikamente reagieren würde. Bei der Untersuchung und Diagnose von Autismus ist die Lage also ähnlich?
Fernández: Ja, in anderen Ländern wie etwa England ist man da schon weiter. Zwar gibt es auch in Deutschland gute Ärzt:innen, aber manche haben eben veraltete Manuale. Ein Beispiel: Bei Jungen erwartet man, dass sie sich für Züge oder Dinosaurier interessieren. Die extreme Variante davon, also ein Kind, das wirklich alles über Züge und Dinosaurier weiß, entspricht eher dem typischen Bild eines autistischen Kindes. Ein Mädchen hingegen, das in ähnlicher Ausprägung alles über Pferde, Barbies oder Popbands weiß, würden Ärzt:innen eher als ganz normales Mädchen ansehen.
Wir sind auch nicht das Klischee Sheldon Cooper [Anm. d. Red.: Eine autistische Figur aus der Comedy-Serie „The Big Bang Theory“], weil man das bei Frauen gar nicht zulässt. Ein männlicher Autist, der als Informatiker arbeitet, wird eher in Ruhe gelassen. Eine Frau mit ähnlichen Eigenschaften wird gemobbt, bis sie sich an das weibliche Geschlechterbild anpasst.
Utopia: Also wird Autismus bei Frauen und Mädchen weniger wahrgenommen und dadurch seltener diagnostiziert?
Fernández: Genau, das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Man ging eine Weile von einem Verhältnis von 4 zu 1 aus, also vier Jungen zu einem Mädchen. Mittlerweile hat man es revidiert auf 2 zu 1. In der Fachwelt sind sich viele einig, dass es bei Mädchen einfach nur unterdiagnostiziert ist und das tatsächliche Verhältnis etwa 1 zu 1 beträgt.
Der steinige Weg zur Diagnose
Utopia: Sie haben ihre ADHS-Diagnose erst mit 25 Jahren bekommen, ihre Autismus-Diagnose mit Mitte 30. Hat die Benachteiligung von Mädchen und Frauen hier eine Rolle gespielt?
Fernández: Vielleicht. Autismus und ADHS galten in den 80ern und 90ern, als ich ein Kind war, noch fast überall als reine „Jungs-Diagnosen“. Der Autismus ist bei mir aber eher die „weibliche“ Ausprägung: Ich bin mehr interessiert an menschlichem Verhalten und eben nicht an Mathematik und Zügen, daher fiel das erstmal nicht so auf. Das ADHS präsentiere ich jedoch sehr „männlich“. Ich war das typische Kind, das keine Hausaufgaben machte, prokrastinierte und eine „Sauklaue“ hatte.
Utopia: Warum wurde das ADHS dann nicht im Kindes- oder Jugendalter bei Ihnen diagnostiziert?
Fernández: Es war eigentlich schon immer klar, das mit mir etwas anders ist. Schon im Kindergarten kam das Jugendamt und hat geschaut, wie ich mich verhalte. Doch das waren die 80er und damals war es eine Schande für die Familie mit dem Kind zu einem Psychologen oder einer Psychologin zu gehen. Aus Angst vor Stigmatisierung scheuen sich viele auch heute noch davor, bei ihren Kindern eine offizielle Diagnose anzustreben.
Utopia: Dennoch war die Diagnose schlussendlich für Sie erleichternd, also eine positive Erfahrung. Warum?
Fernández: Vor allem als erwachsene Frau hat man oft eine längere Odyssee hinter sich. Man wird ausgegrenzt; es gibt ganz hohe Mobbingzahlen. Viele haben einen gebrochenen Lebenslauf, denn man hält es in Berufen nicht aus, wird oft entlassen. Es gibt hohe Quoten der Obdachlosigkeit, Psychiatrieaufenthalte, häufige Fehldiagnosen.
Dann hat man vielleicht noch das Pech, dass es heißt: „Sie haben doch einen Ehemann, sie gucken in die Augen und interessieren sich nicht für Züge, also können sie keine Autistin sein.“ Nichts davon steht in irgendwelchen Kriterien, nicht mal in denen aus den 80ern, und trotzdem passiert das. Jetzt stellen Sie sich mal den Druck vor. Man denkt sich „Was ist da nur los?“ Und dann bekommen Sie irgendwann endlich die Diagnose: Das ist einfach befreiend! Dennoch sollte man es sich gut überlegen, ob man eine Diagnose anstreben will.
Utopia: Wieso?
Fernández: Ein Beamtenverhältnis wird damit sehr schwierig und auch manche Versicherungen nehmen einen nicht. Die Nachteile sind groß und der einzige Vorteil für mich ist die offizielle Bestätigung von etwas, was ich schon wusste, aber unbedingt schwarz auf weiß haben wollte. Zwar gibt es die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, was wiederum Vorteile im Arbeitsrecht mit sich bringt, für mich als Freiberuflerin ist das jedoch nicht relevant.
Neurodivergenz: Viele Ausprägungen, dasselbe Problem
Utopia: Nun beschreibt Neurodivergenz ja aber nicht nur eine Art von abweichendem Verhalten, sondern kann sehr vieles bedeuten. Autismus und ADHS sind zum Beispiel sehr unterschiedliche Konditionen. Ergibt es Sinn, all diese verschiedenen Ausprägungen unter einen Begriff zu packen?
Fernández: Es ist ein Riesenschirm, aber es geht für alle um dasselbe: Barrierefreiheit. Das Problem ist die Gesellschaft, die sehr unflexibel gegenüber Andersartigen ist. Ich habe zum Beispiel auch ein Schlafphasensyndrom, sodass ich üblicherweise nicht vor 4 Uhr nachts einschlafen und nicht vor 12 Uhr aufstehen kann. In einem deutschen Krankenhaus werde ich um 6 Uhr geweckt und esse um 17 Uhr zu Abend. Das ist für mich die Hölle. Als ich eine Weile in Spanien gelebt habe, wo man um 22 Uhr zu Abend ist, passte das mehr zu meinem Biorhythmus.
Utopia: Wie kann man sich die Reaktionen auf dieses doch untypische Verhalten vorstellen?
Fernández: Man wird oft in die Schublade „faul“ gesteckt, wenn man nicht um 6 Uhr morgens draußen den Rasen mäht. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil einfach mein ganzer Biorhythmus gedreht ist. Ich arbeite wie alle anderen meine Stunden und schlafe meine Stunden, nur eben zu anderen Zeiten. Wie bei allen Neurodivergenzen ist das Hauptproblem eine intolerante, inflexible Gesellschaft und die daraus resultierenden Barrieren.
Politische Korrektheit und Ableismus
Utopia: Heutzutage gibt es ja auch immer mehr Diskussionen um politisch korrekte Sprache: Wie sehen Sie das? Ist zum Beispiel das Wort „Betroffene“ angemessen, wenn man über neurodivergente Menschen spricht?
Fernández: Das ist sehr schwierig. Die deutsche Sprache hat leider nicht viele nicht-ableistische Begriffe, die gut funktionieren. Also Begrifflichkeiten oder Formulierungen, die Menschen nicht aufgrund ihrer körperlichen oder psychischen Andersartigkeit diskriminieren.
Utopia: Können sie ein Beispiel nennen?
Fernández: Es gibt zum Beispiel keine gute Übersetzung für „reasonable adjustments “ [Anm. d. Red.: Anpassungen, die ein:e Arbeitgeber:in vornimmt, um Arbeitnehmer:innen mit Behinderungen entgegenzukommen, damit keine Nachteile durch seine/ihre Kondition entstehen.] Also benutze ich oft englische Begriffe. „Betroffene“ versuche ich zu vermeiden.
Utopia: Gibt es eine gute Alternative?
Fernández: Ich nutze lieber den Begriff „neurodivergente Menschen“. Aber ich verstehe auch, dass das nicht immer einfach ist. Man kann nicht immer alles wissen. Ich bin zum Beispiel sprachbegabt, mir fällt das leicht. Aber manche haben Schwierigkeiten, sich verbal auszudrücken. Das direkt als Charakterfehler zu deuten, finde ich ebenfalls ableistisch.
Utopia: Inwiefern hilft Ihnen ihr Psychologie-Studium dabei, mit Ihrer Neurodivergenz und auch dem Verhalten neurotypischer Menschen umzugehen?
Fernández: Es hat mir geholfen, andere Menschen besser zu verstehen. Einiges an neurotypischem Verhalten ist für mich total unlogisch und bizarr. Diese kognitiven Verzerrungen, die manche haben, kommen bei Autist:innen seltener vor. Zum Beispiel, dass sich Menschen einreden können, rauchen sei gesund. Oder dass sie unmoralische Entscheidungen treffen und sie sich das schön reden. Die Inflexibilität, die man uns Autist:innen oft negativ auslegt, kann eben auch bedeuten, dass wir, wenn etwas unfair ist, es auch als unfair betiteln und uns nicht bestechen lassen.
Eine psychologische oder gesellschaftliche Störung?
Utopia: Ist es angesichts der möglichen Vorteile, die Neurodivergenzen auch mit sich bringen können, überhaupt sinnvoll, Autismus und ADHS als Störung zu klassifizieren? Oder ist die Gesellschaft, die mit diesen Menschen nicht korrekt umzugehen weiß, das eigentliche Problem?
Fernández: Das ist sehr individuell und wird unter neurodivergenten Menschen unterschiedlich beurteilt. Psychologisch gesehen sind Autismus, ADHS und Co. schon eine Andersartigkeit, wie das Gehirn und wie die Wahrnehmung funktioniert. Doch zu einer Behinderung oder Einschränkung wird die Neurodivergenz oft erst durch die Wechselwirkung mit der Gesellschaft.
Utopia: Wie meinen Sie das mit der Wechselwirkung?
Fernández: Mein Psychiater, der mich diagnostiziert hatte, sagte mir, dass ich vor 200 Jahren vielleicht als Nonne in einem Kloster gelebt hätte. Dort hätte ich irgendwelche Schriften studiert, eine Kräutersammlung gepflegt und wäre gar nicht aufgefallen. Auch in der heutigen Tech-Branche werden Eigenschaften, die oft auch bei Autismus auftreten, teils sehr positiv bewertet. Jemand, der wenig Barrieren in seinem Leben erfahren hat, wird also vielleicht sagen, sein oder ihr Autismus oder ADHS sei keine Einschränkung. Doch das ist wohl die Minderheit. In der Regel wird man schon von klein auf ausgegrenzt. Jedes zweite Kind aus dem Autismus-Spektrum wird gemobbt. Und es gibt manche, die ihre Erfahrung als neurodivergenter Mensch grundsätzlich nicht besonders angenehm finden. Zum Beispiel ist die Reizfilterschwäche – ein Kennzeichen von Autismus und ADHS, bei dem es einem Menschen schwerfällt, äußere Reize auszublenden – in unserer modernen Welt sehr anstrengend.
Auf Empathie kommt es an
Utopia: Was müsste von Politik und Gesellschaft getan werden, damit neurodivergente Menschen eben keine Einschränkungen mehr fühlen und die Chance haben, sich voll zu entfalten?
Fernández: Ich wünsche mir hauptsächlich Toleranz und Empathie. Uns Autist:innen wird oft Empathie abgesprochen, aber aus unserer Sicht sind Neurotypische uns gegenüber oft sehr unempathisch. Dieses Phänomen wird auch als Double-Empathy-Problem bezeichnet. Keine der beiden Seiten versteht die jeweils andere und wirkt somit empathielos. Was in Deutschland leider zusätzlich noch stark zum Vorschein kommt, sind diese aus dem Dritten Reich beruhenden Menschenbilder, zum Beispiel dass man sich einfach nur zusammenreißen muss. Da steckt noch dieses „hart wie Krupp-Stahl“ drin. Auch wird schnell gesagt, dass Nachteilsausgleich eine Extrawurst sei, oder ein Behindertenparkplatz unfair. Dieses Menschenbild finde ich sehr erschreckend.
Utopia: Sie erwähnten eingangs, dass England schon weiter sei. Auch was diesen Aspekt angeht?
Fernández: Die Menschen dort sind, was Neurodiversität angeht, einfach viel bewusster. Da gibt es gute Gesetze, auf die man sich berufen kann, wenn ein Missstand auftritt. Das klinische Fachpersonal ist dort auch sehr gut ausgebildet und weiß, wie man mit neurodivergenten Menschen umgeht. In Deutschland gibt es ja schon bei Behinderungen, die sichtbar sind, noch viel zu viele Barrieren. Gehen Sie zum Beispiel mal als Frau im Rollstuhl zum Gynäkologen. Da gibt es kaum welche, die das nötige Equipment haben. Ich habe wenig Hoffnung, dass auch noch unsichtbare Behinderungen in naher Zukunft ausreichend berücksichtigt werden. Aber ich würde es mir wünschen, denn es ist gar nicht so schwer.
Utopia: Welche einfachen Änderungen wären denn möglich?
Fernández: Wenn man zum Beispiel Lärmbelastung reduziert oder Wege klarer ausschildert, dann hilft das ja nicht nur neurodivergenten Menschen, sondern ist für alle schön. In vielen Gesprächen habe ich außerdem schon Sätze gehört wie „Mein Vater ist dement geworden und der ist komplett von der Musik im Supermarkt überfordert“. Man sollte beim Thema Barrierefreiheit also einfach auch an sich selbst denken. Weil irgendwann wird man alt sein und ebenfalls Einschränkungen haben.
** mit ** markierte oder orange unterstrichene Links zu Bezugsquellen sind teilweise Partner-Links: Wenn ihr hier kauft, unterstützt ihr aktiv Utopia.de, denn wir erhalten dann einen kleinen Teil vom Verkaufserlös. Mehr Infos.Gefällt dir dieser Beitrag?